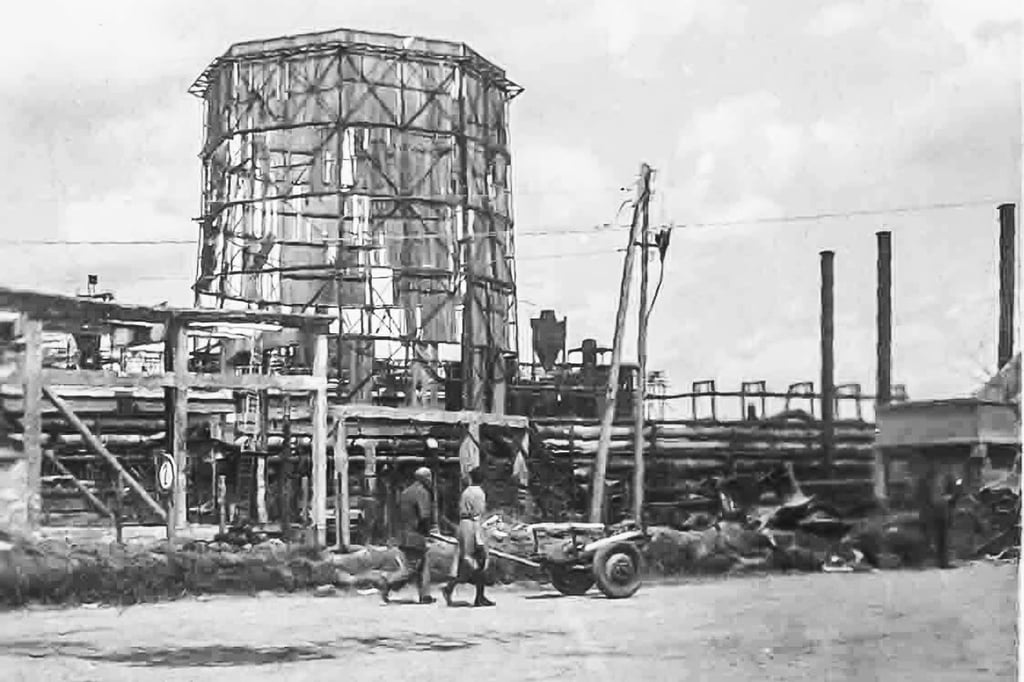Pilzjahr 2017 Pilzjahr 2017: Ich krieg' die Schwämmchen

Wangen - Der Dezember 2017 und der Januar 2018 waren fast durchweg mild, Schnee und Frost kaum zu verzeichnen, was dafür sorgte, dass in der Natur nicht nur Taubnessel und Gänseblümchen vereinzelt blühten, inzwischen bereits Schneeglöckchen auf dem Vormarsch sind und Winterlinge in leuchtendem Gelb blühen - auch in der Pilzflora tat und tut sich einiges. Wer trotz des oft trüben und regnerischen Wetters die Wälder oder Parks durchstreifte, konnte an Totholz und Baumstubben hin und wieder Pilze entdecken, die nicht selten sogar für eine Pilzmahlzeit im Winter ausreichten.
Viel verkehrt machen kann man in dieser Jahreszeit nicht, wenn man die zwei essbaren Winterpilzarten kennt, die es derzeit zu finden gibt. Das sind der Austernseitling, der auch als Zuchtpilz im Sortiment etlicher Supermärkte angeboten wird, und der Samtfußrübling. Während ersterer in unscheinbarem Schiefergrau in seinem dachziegelartigen Wuchs an die Muschelbänke von Austern (daher der Name) erinnert, ist der Samtfußrübling ein „Hingucker“ aufgrund seiner leuchtenden goldorangenen Hüte. Ein wenig erinnert diese büschelig meist an Laubholzstubben wachsende Pilzart an essbare Stockschwämmchen. Allerdings sind die drei bis vier Millimeter dicken Stiele am Fuß fast schwarzsamtig, im oberen Bereich gelb. Die Huthaut ist oft klebrig bis schleimig und sollte vor der Zubereitung der Pilze entfernt werden.
Im Zweifel zur Beratung
Auch, wenn derzeit der Winter sich doch noch eingestellt hat, diese Pilze legen lediglich eine „Frostpause“ ein und können bei wenigen Plusgraden weiter wachsen. Ihre gelborangen Hüte sind in der grauen Jahreszeit im Wald schon von weitem erkennbar. Wer sich unsicher ist, kann gern die Pilzberatungsstellen kontaktieren, die auch in dieser Jahreszeit Auskunft geben werden.
Ein Blick zurück auf 2017 bot einige Höhepunkte im Pilzaufkommen, kann aber nicht mit den ursprünglichen Erwartungen mithalten. Das Pilzjahr 2017 hatte sich seitens der Niederschlagsneigung vielversprechend angekündigt. Nach einem weiteren relativ milden Winter folgten im März Schlechtwetterphasen mit viel Regen (46 Millimeter). Der April fiel trockener und mit einigen empfindlichen Frosttagen auf. Dennoch konnten örtlich gute Funde von Morchelarten verzeichnet werden. Der Mai bescherte einige Maipilzfunde. Es gab regional starke Unwetterereignisse mit großen Regenmengen. Diese konnten nur wenig im Boden versickern und flossen zu schnell ab. Das Trockendefizit vergangener Jahre war damit noch nicht ausgeglichen. Über die Sommermonate waren in 2017 weit mehr Regenereignisse zu verzeichnen, als in den Jahren zuvor. Von Mai bis August summiert sich der Niederschlag auf etwa 324 Millimeter, teils mit Starkregen. Damit war eigentlich die Grundlage für eine gute Pilzsaison geschaffen.
Im Juni/Juli waren im Ziegelrodaer Forst immerhin schon erheblich mehr Pfifferlinge im Vergleich zu den Vorjahren zu finden. Allerdings blieben Steinpilze unter den Erwartungen, Fundmengen fielen punktuell und sehr unterschiedlich aus. Ein eher trockener September mit 27 Millimetern Regen folgte, aber so nach und nach war doch eine breite Artenvielfalt Pilze anzutreffen. Es kann aber nicht von einem Massenwachstum für unsere Wälder (Ziegelrodaer Forst mit Wangener Grund und Langes Gestell sowie Revier Lodersleben) gesprochen werden. Nach Pfifferlingen und Riesenbovisten Ende Juli folgten ab August Schirmpilze und Champignons, die begehrten Röhrlinge hielten sich in Grenzen. Zu den Höhepunkten der Pilzartenspannbreite gehörte Mitte Oktober die öffentliche Pilzwanderung im Ziegelrodaer Forst mit rund 40 Teilnehmern und 55 Pilzarten, die bestimmt werden konnten. Um die 80 Pilzarten konnten an diesem Wochenende durch die zwei Pilzberater für Besucher am Pilzberatungsstand Hermannseck ausgestellt werden.
Noch zwei weitere Wanderungen führten in die Wälder des Ziegelrodaer Forstes und die letzte der Saison in den Gutschgrund bei Steinbach/Bad Bibra. Allerdings waren bei dieser letztgenannten Exkursion nur noch 15 Pilzarten zu finden. Man kann sagen, mit dem Oktober endete auch die Hochsaison der Pilze, was dazu führte, dass über den November hinaus bis Anfang Dezember bei nur wenigen leichten Frosttagen sogar noch etliche Herbstpilzarten, wie Hallimasch und Stockschwämmchen, aber selten Röhrlinge zu finden waren.
Funde zu jeder Jahreszeit
Fazit ist, dass über die Sommermonate hinweg bis in den Herbst sich das Pilzjahr so gestaltete, dass eigentlich fast immer im Wald und auf Wiesen Pilze anzutreffen waren. Ab Mitte Mai starteten die Röhrlinge mit dem Flockenstieligen Hexenröhrling (essbar), die Steinpilze, Birkenpilze und Rotkappen blieben über die gesamte Saison im Wachstum eher verhalten. Gutes Aufkommen war mit Maronen und Arten der Familie der Schmierröhrlinge (Butterpilze, Körnchenröhrlinge) zu beobachten. Pilzberater Hartmut Berger aus Steigra stellte fest, dass die Mykorhizzapilze (Symbiose Pilz und Baum) ein verhaltenes Wachstum zeigten, viel mehr waren die sogenannten Streubewohner wie Graukappen, Trichterlinge, Täublinge, Schirmpilze und Champignons zu finden. Auch zahlreich wuchsen Milchlinge. Unter den häufig gefundenen Pilzarten ist auch der Pfifferling zu nennen, außerdem Semmelstoppelpilze und bemerkenswert zahlreich Boviste; vom Flaschenstäubling bis hin zum Riesenbovist reichte in dieser Familie die Palette.
Die Autorin ist langjährige Pilzsachverständige und -beraterin.