Streit um Herz-Erkrankungen Streit um Herz-Erkrankungen: Was sagen Cholesterinwerte wirklich aus?
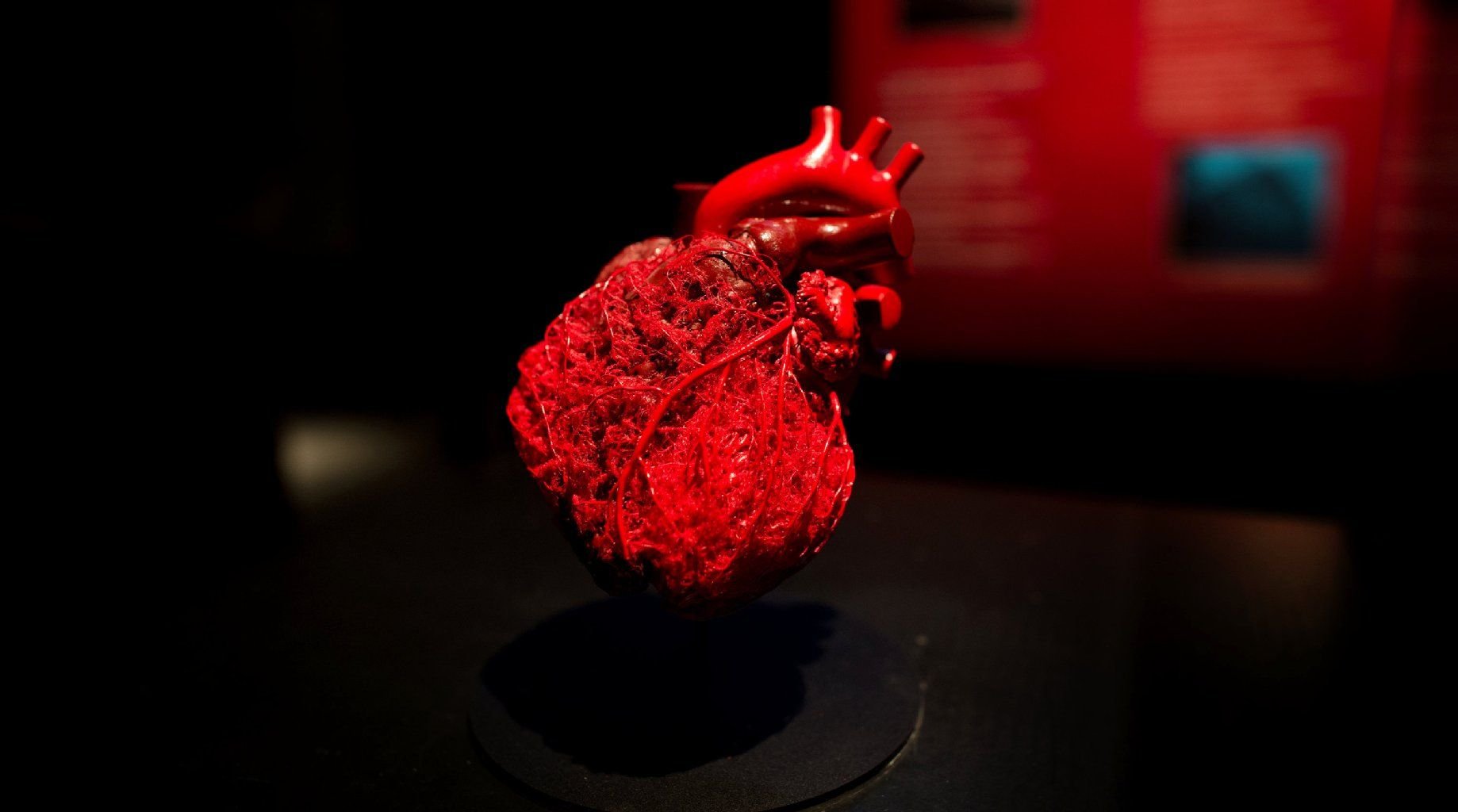
Berlin/MZ - Über das Cholesterin haben Mediziner schon immer trefflich gestritten. Cholesterin – ein Risikofaktor? „Nicht möglich“, wehrten bis Anfang der 80er Jahre viele Ärzte ab und hielten Herzinfarkt und Schlaganfall bei Menschen mit hohen Blutfettwerten weiter für eine normale Alterserscheinung.
Dreißig Jahre später besteht kaum noch Zweifel: Die Grundlage für derartige Attacken wird gelegt, wenn fettreiche Ernährung oder fehlerhafte Gene das Cholesterin im Blut auf ungesunde Werte ansteigen lassen, das Fett sich in den Wänden der Gefäße ablagert, Entzündungszellen anlockt und die Adern immer weiter zuschwellen lässt.
LDL gilt als die gefährlichste Form des Blutcholesterins
Grund zu streiten gibt es dennoch weiterhin: Was ist eigentlich ein ungesunder Wert? Darüber sind sich längst nicht alle einig. Im Blick hat man dabei für gewöhnlich das sogenannte LDL (Low Density Lipoprotein), die gefährlichste Form des Blutcholesterins. Der neueste Trend aus den USA sieht jedoch anders aus. Amerikanische Kardiologen möchten einen Risikorechner etablieren, der mehr als nur die Blutfettwerte abfragt, um herauszufinden, ob jemand herzinfarktgefährdet ist oder nicht.
Ein kurzer Blick zurück. „Alles über 160 Milligramm LDL pro Deziliter Blut ist schädlich“, legten Experten 1988 fest. Auf 100 Milligramm pro Deziliter korrigierte die US-Fachgesellschaft schon vier Jahre später. Diskutiert wurden außerdem 70 Milligramm, wie die in puncto Ernährung und Herzgesundheit als vorbildlich geltenden Yanomami-Indianer im tiefsten Amazonas-Urwald es vormachen, oder gar 59 Milligramm – nach den Berechnungen mancher Mediziner das Ideal, bei dem die koronare Herzkrankheit wohl ausgerottet wäre.
Brisant ist die Grenzwertfrage seit Ende der 80er Jahre. Denn mit den sogenannten Statinen bekamen die Ärzte damals erstmals ein Mittel in die Hand, um die Blutfettwerte ihrer Patienten auch ohne Sport und Diätpläne zu senken. Seitdem hat die Suche nach dem idealen, therapeutisch anzusteuernden Blutfettwert auch praktischen Nutzen.
Kardiologenwelt in Aufruhr
Doch wie lässt sich der ideale Wert finden? Vor vier Jahren entschieden sich die US-amerikanischen Fachgesellschaften, die Frage ein für alle Mal zu beantworten. Ihre Experten zogen sich zurück, um alle wissenschaftlichen Daten zum Thema neu zu sichten. Ende 2013 stellten sie ihre Ergebnisse vor – und brachten damit die Kardiologenwelt erst recht in Aufruhr. Auf der Jahreskonferenz der US-Herzmediziner sei es geradezu zu Tumulten gekommen, berichtet die NewYork Times. Denn die Ergebnisse der Kommission kommen einer Revolution gleich.
Bisher hatten die Mediziner für ihre Therapie ganz klare Vorgaben: Mehr als 130 Milligramm LDL-Cholesterin je Deziliter Blut wollten die früheren Leitlinien-Autoren nicht akzeptieren bei Patienten mit mehreren Risikofaktoren wie Rauchen oder hohem Blutdruck. Das sind immerhin zehn Milligramm pro Deziliter weniger als der Durchschnittsdeutsche aufweist. Das vorbildliche Yanomami-Indianer-Niveau von 70 Milligramm strebte man bei Patienten mit einem überstandenen Herzinfarkt an. Um diese Werte zu erreichen, so hatten die vorigen Leitlinien-Autoren verfügt, sei jedes blutfettsenkende medikamentöse Mittel recht.
Konkretes Risiko des Patienten soll entscheidend sein
Damit ist nun Schluss: Fortan, so lautet der Kern der neuen Leitlinie, soll nicht mehr ein abstrakter Blutfettwert darüber entscheiden, ob ein Patient Pillen schluckt oder nicht. Ausschlaggebend ist allein sein konkretes Risiko, tatsächlich eine Attacke zu erleiden. Dazu teilt die neue Leitlinie alle Menschen grob in drei Gruppen ein: Zur ersten Gruppe gehören stark infarktgefährdete Patienten mit einem Diabetes, einer Herzkrankheit oder einem LDL-Cholesterinwert jenseits von 190 Milligramm pro Deziliter. Die zweite Gruppe bilden gefährdete Patienten, die einem neuen Risikorechner nach mit einer Wahrscheinlichkeit von 7,5 Prozent mit einem kardiovaskulären Ereignis rechnen müssen. Alle übrigen werden der dritten Gruppe zugeordnet. US-Herzmediziner wollen sich ihre Therapie nicht mehr allein von den Blutfett-Richtwerten diktieren lassen.
Konkrete LDL-Zielwerte sollen bei dieser Therapie nicht mehr angepeilt werden. Stattdessen wird allen Patienten das regelmäßige Schlucken des gleichen Mittels empfohlen: Ein Statin soll es sein. Schließlich hätten alle anderen Blutfettsenker – darunter der auch in Deutschland beliebte Wirkstoff Ezetimib (Handelsnamen: Inegy und Ezetrol) – nie belegen können, dass sie tatsächlich Herzinfarkte und Schlaganfälle verhindern.
Weitere Risikofaktoren neben den Blutfettwerten
„Man kann nicht jede Verbesserung eines Laborwerts automatisch gleichsetzen mit der Verbesserung der Gesundheit des Patienten“, sagt der renommierte Kardiologe Harlan Krumholz von der Yale-Universität, der der Kommission nicht angehörte. Medikamente hätten immer viele verschiedene, teilweise auch entgegengesetzte Effekte. Krumholz: „Die bisherige Fixierung auf Cholesterinzielwerte hat dazu geführt, dass wir das oft ignoriert haben.“
Die Entstehung einer Arteriosklerose scheint offensichtlich komplexer zu sein, als sich das viele Mediziner bisher eingestanden haben. Neben den Blutfetten spielen Risikofaktoren wie Diabetes, Bluthochdruck und Zigaretten eine entscheidende Rolle. Auch die Statine seien möglicherweise nicht allein wegen ihrer blutfettsenkenden Wirkung so erfolgreich, sagt Krumholz. Schließlich ist bekannt, dass sie auch Entzündungsreaktion und Blutgerinnung bremsen, die zum Gefäßverschluss beitragen.
Kritiker in Europa finden niedrige Cholesterinwerte aussagekräftig
Dennoch sind auch in Europa viele Experten nicht einverstanden mit der neuen Richtung: „Wenn man auch die indirekten Hinweise berücksichtigt, ist ganz klar, dass ansonsten gesunde Patienten mit den niedrigsten Cholesterinwerten auch die beste Prognose haben“, sagt Helmut Gohlke, der Vorsitzende der Projektgruppe Prävention der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Die Europäische Kardiologische Fachgesellschaft habe deshalb gerade beschlossen, dass die auch in Deutschland geltende Leitlinie – die erst 2012 die hiesigen Grenzwerte verschärfte – nicht nachgebessert werden müsse. Eine Therapie mit klaren Zielwerten lasse sich oft nicht nur dem Patienten besser vermitteln, sagt der Bad Krozinger Mediziner: „Man kann auch besser überprüfen, ob sie optimal verläuft.“
Die unabhängige Fachzeitschrift Arznei-Telegramm hält das amerikanische Papier gar für eine Mogelpackung. Die Fachleute haben errechnet: Wenn jeder Erwachsene mit einem kardiovaskulären Risiko von 7,5 Prozent demnächst ein Statin erhielte, würden 700 Menschen regelmäßig Pillen schlucken müssen, um einen einzigen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu verhindern.
Schweres Geschütz
Auch andere Experten sehen die Statin-Fixierung kritisch: „Die Amerikaner sind eigentlich viel rigoroser als wir“, sagt Heribert Schunkert, Chef der Kardiologie am Deutschen Herzzentrum München. „Wenn ich von Anfang an mit den stärksten Statinen mein schwerstes Geschütz auffahre, dann bringt Kontrollieren tatsächlich nichts mehr.“
Allerdings ist auch die europäische Maßgabe kaum weniger zimperlich: Hier ist schon ab einem Risiko von fünf Prozent und dem unterdurchschnittlichen LDL-Wert 100 Milligramm pro Deziliter vermerkt: „sofortige medikamentöse Intervention“.
Im renommierten Medizinfachblatt Lancet hat der Bostoner Herzmediziner Paul M. Ridker kürzlich ausgerechnet, dass zumindest der neue Risikorechner seiner Kollegen eindeutig zu rigoros sein könnte.
Weil der mit veralteten Daten arbeitet, gibt er die Infarkt- und Schlaganfallwahrscheinlichkeit eines Patienten wohl im Durchschnitt um 100 Prozent zu hoch an. Seitdem prasselt die Kritik erst richtig auf die Autoren ein. Dabei hatte sogar Ridker den Kollegen eines zugestanden: „Prinzipiell bleiben diese Leitlinien ein großer Schritt in die richtige Richtung“, so der Mediziner.





