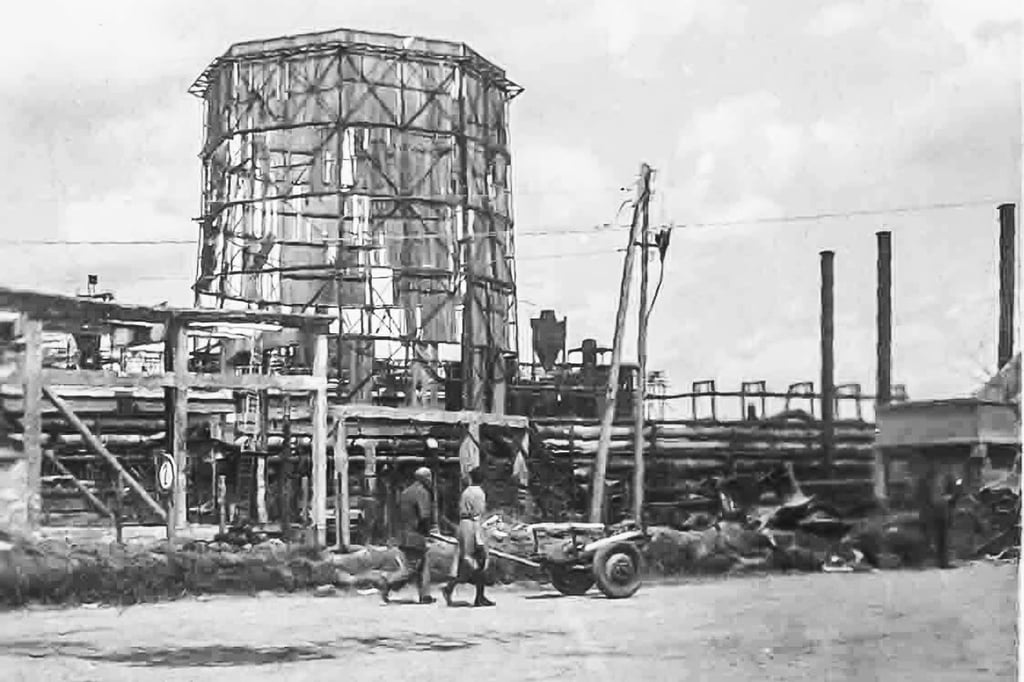Auszeichnung Interview: Mit Klopstockpreis geehrt - Autor Uwe Kolbe über sein Werk und Politik
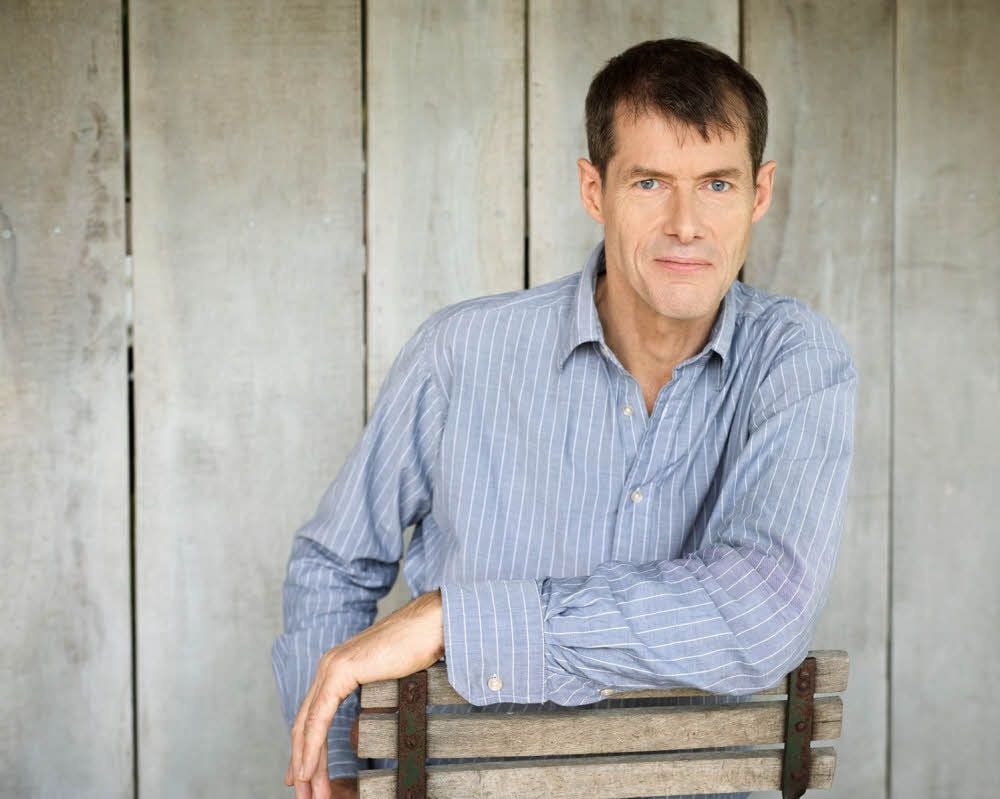
Hamburg - Am Sonntag wird Uwe Kolbe (58) in Stendal mit dem Klopstockpreis des Landes geehrt. Die Auszeichnung wird dem in Hamburg lebenden Autor für sein lyrisches und episches Gesamtwerk verliehen. Mit Kolbe sprach unser Redakteur Christian Eger.
Herr Kolbe, Sie werden im Namen Klopstocks geehrt. Der Dichter ist heute weithin vergessen. Zu Recht?
Uwe Kolbe: Auf keinen Fall. Ich empfehle, um eine differenzierte Sicht zu erhalten, Arno Schmidts Rundfunkaufsatz aus den 50er Jahren: „Klopstock, oder Verkenne Dich Selbst!“. Schmidt verreißt Klopstocks „Messias“ vollständig, um dann von den Oden bis hin zu den theoretischen Texten vieles zu loben. Mein Hausgott war ja früh Hölderlin, der hatte ein Streben nach „Klopstocksgröße“ nie verhohlen. Was bei Klopstock poetisch auf eine spröde Art begann, gewann bei Hölderlin eine geschmeidig schöne Art und Weise. Auch deshalb freue ich mich über die Ehrung. Das ist ein Preis für dich, habe ich mir gesagt. Das geht.
Was ist bei Klopstock zu finden, was sonst kein Dichter bietet?
Kolbe: Die Geste des Barden, des Dichter-Sängers. Alles was danach kam, hat diesen großen Griff nie wieder versucht. Klopstock war literarisch ein Bahnbrecher, ein Wegbereiter, die Sachen, die nach ihm kamen, waren aber vollendeter, lesbarer.
Er war seinem Anspruch nach ein früher Großschriftsteller.
Kolbe: Absolut. Es ist bekannt, dass er in seiner Abiturrede in Schulpforte erklärte: Deutschland braucht einen Schriftsteller, der ein Menschheits-Epos erschafft - und dieser Autor bin ich.
In Ostberlin 1957 geboren, übersiedelte Uwe Kolbe 1988 nach Hamburg, wo er heute, nach Jahren in Tübingen und Berlin wieder lebt. Von Franz Fühmann gefördert, debütierte er 1980 mit dem vielbeachteten Lyrikband „Hineingeboren“. Es folgten u. a. die Gedichtbände „Bornholm II“, „Vaterlandkanal“, zuletzt „Gegenreden“, zudem Essays wie „Renegatentermine“ und „Vinetas Archive“. Der Klopstockpreis ist dotiert mit 12.000 Euro. Verleihung am Sonntag, 11 Uhr, Theater Stendal. Den Förderpreis erhält Michael Spyra.
Unter den Dichtern der DDR avancierte Klopstock nach 1961 zu einem sehr angesagten Autor. Warum?
Kolbe: Das ist etwas Merkwürdiges. Da sieht man den Einfluss von Lehrern. In diesem Fall von Georg Maurer, dem großen Klassizisten, der in Leipzig am Literaturinstitut unterrichtete. Er hatte die damals jüngeren Dichter - Mickel, Braun oder die Kirschs - sehr beeinflusst. Maurer hatte Klopstock aufs Tapet gebracht als formalen poetischen Anspruch und als Vermittler der Klassik. Daraus wurde der sozialistische Klassizismus dieser Generation, der Urstände feierte in den 60er Jahren. Im Riesenunterschied zum Westen, der antilyrisch war. Brinkmann zum Beispiel holte zur selben Zeit die Amerikaner rein.
Klopstock wird auch in Ihrem jüngsten Buch „Brecht. Rollenmodell eines Dichters“ erwähnt. Das Buch ist eine Generalkritik an Brecht. Was hat Sie dazu veranlasst?
Kolbe: Die Publikumsgespräche zu meinem Roman „Die Lüge“. Es wurde gefragt: Woher stammt die für viele DDR-Künstler typische persönliche und ideologische Indolenz, also die Gleichgültigkeit der eigenen Lebensform gegenüber? Die Ignoranz auch gegenüber Frauen, die nichts anderes war als die Art und Weise der Mächtigen, dieser Männerwelt. Vorbild dafür war Brecht, das war die prägende Matrix-Patrix. Auch politisch. Brecht hatte vorgemacht, wie man auf dem linken Auge blind sein kann. Wie man Stalin nicht nur alles durchgehen lassen, sondern die Sowjetunion auch noch bis zum letzten Atemzug verteidigen kann - gegenüber allem Anderen, was dann automatisch „Faschismus“ hieß.
Diese Haltung war schulbildend?
Kolbe: Absolut. Sie war etwas wie eine Falle. Insbesondere für uns, die ostdeutsche Intelligenzija, deren Problem war ja der abstrakte Antifaschismus. Ich sage an dieser Stelle „wir“, weil ich vielleicht der letzte Spross dieser Richtung war. Selbstverständlich hatte ein Ostdeutscher Probleme mit den Begriffen Patriotismus oder Nation zu haben. Brechts Haltung hatte noch biografische Gründe, die Nachgeborenen waren nur gelähmt.
Das vereinigte Europa auf der Kippe
Sie schrieben 1989, dass Sie ein „undeutsch (und drum ungeteiltes) Land, gleichweit entfernt von Daimlerland und Preußen“ suchen.
Kolbe: (lacht) Genau das war’s. So sehr saß ich in der Falle. Da war ich noch auf dem gleichen Trichter wie Wolf Biermann, den ich als Brecht-Erben zitiere, der den Wechsel von Ost nach West als Fall vom „Regen in die Jauche“ beschrieb. Aus antikapitalistischer, spätkommunistischer Sicht wird die bürgerliche Demokratie zur Jauche erklärt. In dem Fußabdruck saßen alle von Heiner Müller bis Thomas Brasch.
Wie blicken Sie heute auf Deutschland?
Kolbe: Ich sehe das mir so angenehme Projekt des vereinigten Europas auf der Kippe. Und ich merke, es geht mich an. Ich fange an, mir konzeptionell Dinge zu überlegen, auch wenn ich kein politischer Denker bin.
Plötzlich habe ich das Bild, Europa würde erst etwas sein in den Grenzen des Römischen Reiches, sprich, wenn es den Norden Afrikas, das Mittelmeer wieder eingemeindet. Auf diplomatische, außenpolitisch klare Art und Weise, unter Einschluss aller drei monotheistischer Großreligionen. Der Zeitgenosse phantasiert. Aber der Dichter bleibt bei seinem Leisten.
Zu dem gehört die Sprache. Auch die öffentliche. Wie steht es um die?
Kolbe: Es ist nach wie vor so, dass die verwaschene Machtsprache der Politiker uns im Regen stehen lässt. Es braucht eine starke, klare Rede - und zwar von allen politischen Seiten. Die Art und Weise etwa, wie sich öffentlich mit AfD und Pegida auseinandergesetzt wird, halte ich für grundsätzlich falsch. Das ist eine sprachliche Ausgrenzung. Dabei geht es um keinen „Rand“. 20 Prozent sind kein Rand.
Was wäre die Alternative? In Dresden zu Pegida zu sprechen?
Kolbe: Was in Dresden die Landeszentrale für politische Bildung unternommen hat, das war gut. Ins Gespräch gehen. Offensiv sein. Nicht billig mit dem Finger zeigen. Als Bürger verlange ich Klarheit und Genauigkeit.
Und was verlangt der Dichter?
Kolbe: Er hat nach 1989 das Attribut „politisch“ abgelegt. Ich bin einer, der Gedichte schreibt, und ich bin einer, der, wenn es ihn als Zeitgenosse juckt, mit einer Mitteilung an die Öffentlichkeit geht. Aber das Gedicht, die Kunst, das ist nicht der Ort, wo für mich Politik stattfindet.
Warum nicht?
Kolbe: Politik ist das Machen des jeweils Zweckmäßigen. Das Gedicht, also die Poesie, stiftet Sinn. Sie liegt vor aller Politik, vor der Kodierung des Rechts, sogar vor der Philosophie. Sie spricht von der Natur, vom Menschen, von Gott und den Göttern. Und wenn ich den Mythos von Orpheus recht verstehe, ist das keine Einbahnstraße: die drei hören dem Gedicht sogar zu.
(mz)