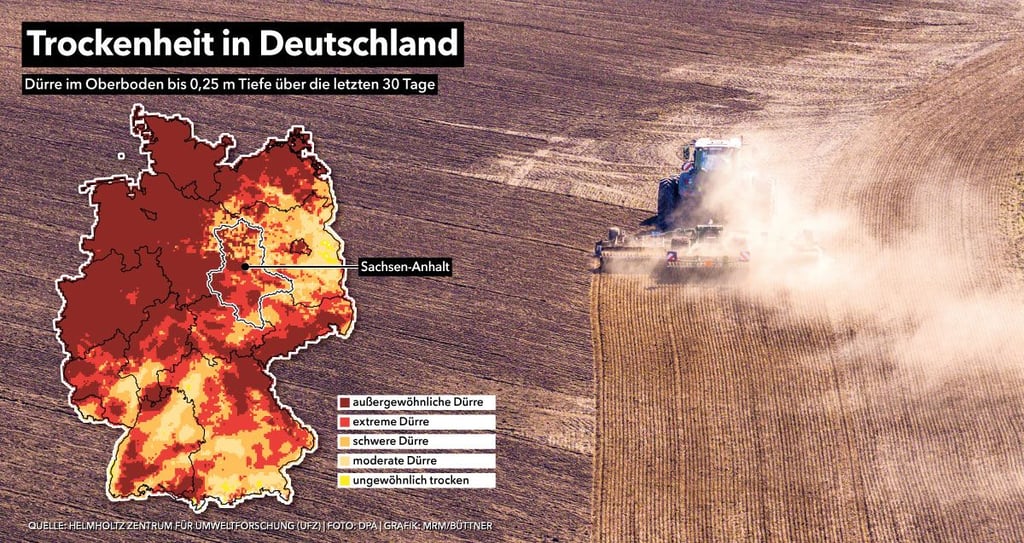Braunkohle-Abbau Braunkohle-Abbau: Als Ost und West einst gemeinsame Sache machten

Harbke/Helmstedt - Wer auf der A2 die Abfahrt Marienborn/Helmstedt nimmt, die B1 ein Stück gen Westen fährt und nach links auf die B245a abbiegt, passiert ein großes braunes Schild am Straßenrand, mitten auf einer Wiese. Es weist darauf hin, dass Deutschland und Europa hier bis 1989 geteilt waren.
Könnte dieses Schild schwimmen, man müsste es ein paar hundert Meter weiter westlich mitten in den Lappwaldsee stellen, einen ehemaligen Braunkohletagebau zwischen Harbke, Sachsen-Anhalt, und Helmstedt, Niedersachsen. Zentimeter um Zentimeter steigt das Wasser. 2032 soll der See fertig geflutet sein. Die Zielmarke: 420 Hektar Wasserfläche, das entspricht fast 600 Fußballfeldern.
Der Lappwaldsee als Besonderheit
Tagebaue zu Erholungslandschaften, in Mitteldeutschland ist das nicht außergewöhnlich. Doch dieser See ist kein gewöhnlicher, der Tagebau war es auch nicht. Mitten durch die Abbauzone verlief bis 1989 die deutsch-deutsche Grenze. Zwischen 1976 und 1983 teilten die DDR und die Bundesrepublik sich den Abbau eines 15 Millionen Tonnen schweren Kohleflözes mitten unter der Staatsgrenze, mit Ausläufern nach Ost und West. Sein Name: Grenzkohlepfeiler.
Europas am stärksten gesicherte Grenze, die nicht nur Menschen voneinander trennte, sondern auch politische Systeme - in der Börde hatte sie ein Loch. Nur ein Maschendrahtzaun trennte im Tagebau Kohlekumpel Ost von Kohlekumpeln West. Im Zaun zwei Türen, die alle drei Monate geöffnet wurden. Zum Austausch von Unterlagen und Informationen.
Wachpersonal? Nur Männer in Zivil mit Hunden. Unbewaffnet. DDR-Grenzsoldaten hatten an dem Zaun nichts zu suchen, genauso wenig wie der westdeutsche Bundesgrenzschutz. So sah es eine Vereinbarung zwischen beiden deutschen Staaten vor. „Der Tagebau war offen wie einen Scheunentor“, sagt Werner Müller und lacht ein dröhnendes Lachen. „Wer wollte, hätte hier jederzeit rübermachen können.“ Anders als sonst an der Grenze üblich, habe es auch keine Selbstschussanlagen gegeben.
Müller, 67, ist Bürgermeister in Harbke, 1.800 Einwohner. Ein hemdsärmeliger Typ, und einer derjenigen, die die Erinnerung an dieses besondere Kapitel deutsch-deutscher Geschichte wachhalten wollen. Müller kennt in Harbke jeden Stein. Zum ehemaligen Tagebau geht es durch holprige Straßen, vorbei an Fachwerkhäusern, über Schotterpisten hinab in ein Tal. Zur Rechten glitzert der Lappwaldsee in der Sonne. Am gegenüberliegenden Hang steht ein Hochsitz - noch. „Das Tal soll komplett geflutet werden“, sagt Müller. Er macht eine Handbewegung vom rechten zum linken Ufer: „Ungefähr dort verlief die Grenze.“
DDR war auf Kohleverstromung angewiesen
In der DDR arbeitete Werner Müller als Elektriker im Braunkohlekraftwerk Harbke. Seine frühere Arbeitsstätte ist der Grund dafür, dass die deutsch-deutsche Grenze in dem Bördedorf ein Loch hatte. „Wenn man den Grenzkohlepfeiler nicht ausgebeutet hätte, hätte man das Kraftwerk 15 Jahre früher dicht machen müssen.“ 1975 statt 1990. Doch die DDR sei auf die Kohleverstromung angewiesen gewesen. Und auch der Westen hatte angesichts der sich Anfang der 1970er Jahre weltweit abzeichnenden Ölkrise großes Interesse an der Kohle aus dem Grenzgebiet. Müller formuliert es so: „Die wirtschaftliche Notwendigkeit hat hier politische Brücken gebaut.“
So durchlässig die Staatsgrenze im Tagebau war, so handverlesen waren diejenigen, die dort arbeiteten. Die Staatssicherheit und die Volkspolizei durchleuchteten Kohlekumpel wie Wachleute. In Frage kam nur, wer den Behörden als politisch zuverlässig galt. Oberste Kriterien dafür, so erinnert Müller sich: keine Westkontakte. Und Familie. So wollte man das Risiko einer Flucht in den Westen verringern. „Mich haben sie auch mal gefragt, ob ich Wachmann werden will“, erzählt Müller. Er wollte nicht. „Ich hätte jeden Kontakt zu meinen Verwandten in Helmstedt abbrechen müssen. Das kam nicht in Frage.“
Offenbar ging die Taktik der Behörden aber auf. Reiner Orlowski jedenfalls kann sich „in sieben Jahren Grenzkohlepfeiler“ an keinen einzigen Fluchtversuch erinnern, „obwohl es die Möglichkeit gegeben hätte“. Der schlanke alte Herr, 78, war in der DDR zeitweise Sicherheitsbeauftragter. Als solcher musste er sich nicht nur darum kümmern, dass im Tagebau nichts zusammenfiel. Sondern auch ein Auge aufs Personal haben. Wer in der Abbauzone arbeitete, brauchte einen speziellen Passierschein, den „Sonder-Ausweis A“. Den gab es bei Reiner Orlowski. Doch auch ohne dieses Papier wusste jeder im Dorf Bescheid: Es sprach sich rasch herum, dass die DDR im Tagebau gemeinsame Sache mit dem Westen machte.
Drei Jahre vor dem Ende der DDR stieg der Bergbau-Ingenieur zum Betriebsleiter im Ost-Tagebau auf. Heute ist auch er einer derjenigen, die die Erinnerung an den deutsch-deutschen Braunkohleabbau wachhalten wollen. Orlowski macht das mit Akribie. Er hat Unmengen an Unterlagen zusammengetragen - Fotos, Lagepläne, Passierscheine, amtliche Schreiben.
Die innerdeutsche Grenze hat Menschen das Leben gekostet. Sie hat Familien, Freunde und Arbeitskollegen getrennt. Sie hat Verkehrsadern durch- und Lebensadern abgeschnitten. In Harbke begannen die Probleme 1952, als die DDR begann, die Grenze zu sichern (siehe „Sperrzonen an der Grenze“). Für das Harbker Kraftwerk hatte das fatale Folgen: Es wurde bis dato bestückt mit Kohle aus einem Tagebau bei Helmstedt - doch der war nun unerreichbar. „Es gab plötzlich keine Kohle mehr“, sagt der heutige Bürgermeister Müller. „Die Verbindung war schlagartig unterbrochen.“
Nach 10 Millionen Tonnen Kohle für die DDR war Schluss
Also erschloss die DDR einen neuen Tagebau. Das ging einige Jahre gut. Doch allmählich wurde auch dort die Kohle knapp. So geriet schließlich der Grenzkohlepfeiler in den Blick der DDR-Energieplaner. 1983 war auch damit Schluss - die zehn Millionen Tonnen Kohle, die der DDR zustanden, waren abgebaggert.
Vom Kraftwerk Harbke sind nur noch ein paar Werkstattbaracken geblieben, das Pförtnerhäuschen und das Schalthaus, ein langgestreckter Koloss aus roten Ziegelsteinen, denkmalgeschützt. Firmen sind hier eingezogen. Vor dem Gebäude erinnern eine Bergbaulokomotive und eine Lore an frühere Glanzzeiten. Der einstige Kraftwerkselektriker Müller denkt schon weiter. Er will die Geschichte des Harbker Ost-West-Kohleabbaus touristisch vermarkten - wenn erst einmal der Lappwaldsee fertig geflutet und zum Naherholungsgebiet geworden ist. Seine Idee: eine Hängebrücke quer über den See, die den einstigen Grenzverlauf markiert.
Die Grenze würde dann verbinden, nicht mehr trennen. (mz)