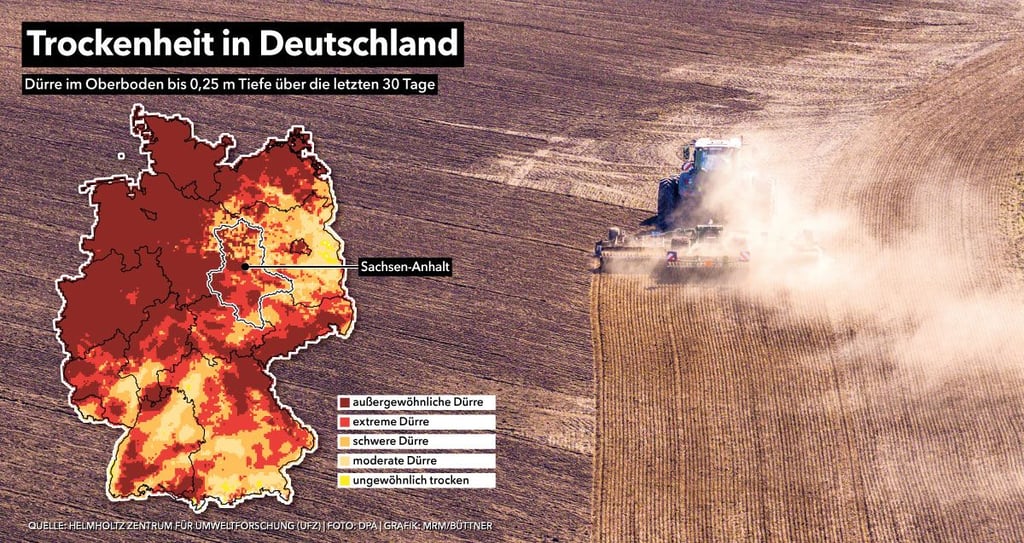Drohnen auf dem Acker Drohnen auf dem Acker: Bauern setzen auf neueste Technik

Bernburg/MZ - Es surrt wie eine Nähmaschine, ist nicht größer als ein aufgeklappter Regenschirm, mit Akkus und Spezialtechnik an Bord wiegt das Gerät nicht einmal fünf Kilogramm. Mit diesem Luftfahrzeug - einer Drohne für die Landwirtschaft - ist der kleine Stand von Jörg Ruppe einer der Anziehungspunkte bei den am Dienstag eröffneten Feldtagen in Bernburg-Strenzfeld (Salzlandkreis).
Die dreitägige Veranstaltung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft gilt als die Innovationsplattform für die Pflanzenproduktion in Mitteleuropa. Erwartet werden mehr als 20 000 in- und ausländische Fachbesucher, die Antworten auf drängende Fragen suchen.
Zum Beispiel: Wie kann verhindert werden, dass Rehe die Arbeiten auf den Feldern behindern und dabei selbst zu Schaden kommen? Entwickler Ruppe, ein Absolvent der Martin-Luther-Universität in Halle, will mit Hilfe einer Drohne Landwirten und Tieren den Ausweg zeigen. Sein mit einer Wärmebildkamera ausgestattetes Fluggerät ortet die Rehe in einem vorab programmierten Zielgebiet, gibt die Informationen an den Maschinenfahrer weiter, der dann mit einem Ausleger einen Fangkorb über das Rehkitz stülpt.
Die Neuentwicklung, teils finanziert mit EU-Mitteln, resultiert aus einer Zusammenarbeit mit studentischen Entwicklern von der Hochschule Harz. Die Drohne kann käuflich erworben oder gemietet werden. Die Preise, so der Anbieter, variieren von Fall zu Fall. Aber nur selten kostet ein Drohnen-Einsatz weniger als 750 Euro.
Auf der nächsten Seite: Drohnen retten Tierleben und können den Unternehmen Geld sparen.
Funktioniert alles, bleibt das Tier, das in den ersten Wochen seines Lebens instinktiv nicht flüchtet, am Leben. Der Vorteil des Drohnen-Einsatzes für den Landwirt: Es gibt keinen Unfall und damit auch keine Ausfallzeiten der Technik. Und der Bedarf an einem praktikablen Konzept ist offenbar groß. Innerhalb einer Stunde melden sich 21 Interessenten für ein Beratungsgespräch an. Jährlich, so schätzen Experten, sterben bei Feldarbeiten 100 000 junge Rehe. Das sind auch 100 000 Störfälle.
Ebenso lassen sich Drohnen für viele andere Zwecke nutzen. Allein Ruppes kleine Firma aus der Nähe von Jena, die zwölf Mitarbeiter zählt, bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an. So ist für Jens Brühl vom amerikanischen Saatguthersteller Monsanto interessant, wie eine Drohne die Daten von kleinen Versuchsflächen erfassen kann. „Wenn man so das Wachstum der Pflanzen verfolgen könnte, wäre das einen gewaltige Zeitersparnis.“ Niemand müsste dann noch mit Messlatten durch die Reihen gehen und die Ergebnisse aufschreiben.
Dass eine solche Präzision möglich ist, glaubt Drohnen-Pilot und Programmierer Martin Milbradt guten Gewissens versichern zu können. Acht Mini-Rotoren halten ihm zufolge das Gerät, wenn erforderlich, punktgenau und auch in niedriger Höhe in der Luft. Andererseits könne es aber auch innerhalb von 20 Minuten einen Schlag von gut fünf Hektar dokumentieren. Forstwirte, die mit der Zeit gehen, wissen so etwas bereits zu schätzen. Erst mit dem Wissen aus der Luft, der Flug erfolgt in diesem Falle in einer Höhe von 30 bis 50 Metern, lassen sich beispielsweise Holzvorräte bis auf den Kubikmeter ermitteln. Auch zur Schadensdokumentation sind Drohnen-Überflüge geeignet. Sogar der Befall von Parzellen durch Mäuse kann anhand der ermittelten Löcher im Boden eingeschätzt werden. Jede neue Einsatzvariante, so Ruppe, erfordert jedoch einige zusätzliche Vorbereitungen. Unter anderem müsse die Software angepasst werden. Vielleicht sind auch noch zusätzliche Sensoren nötig.
Auf der nächsten Seite: Feldroboter im Härtetest.
Eine ganz andere Richtung, um satte Ernten einzufahren, verfolgen die Entwickler von Feld-Robotern. Auch sie geben sich in Bernburg ein Stelldichein. Der Härtetest ist am Donnerstag geplant: Beim Field Robot Event gilt es, Aufgaben in fünf Disziplinen zu lösen - auf dem Versuchsfeld. Hans Walter Brandt, Hannes Harms und Denny Behnecke von der Technischen Universität Braunschweig testen mit ihrem „Helios“, wie sie das Mini-Fahrzeug nennen, noch die optimale Programmierung. Möglichst schnell und präzise soll der Roboter durch die Reihen fahren, Hindernisse aufspüren und Lücken in den Pflanzenreihen registrieren. Später, mit anderen Sensoren ausgerüstet, kann er möglicherweise sogar verschiedene Unkräuter identifizieren.
Maschinenbaustudentin Michaela Pussack sieht das Tempo von „Helios“ kritisch. „Nur einen Kilometer pro Stunde legt er zurück, zu wenig.“ Bei der Suche nach einer Lösung verspricht sie sich Anregungen vom Gedankenaustausch mit den anderen 23 Teams, die ebenfalls mit Robotern bei den Feldtagen vertreten sind. Erste Probefahrten liegen auch hinter den Niederländern, Dänen, Finnen, Tschechen und Türken. Das Zwischenergebnis: Niemand ist perfekt. Anders als bei ausgereifter Drohnen-Technik, glauben Fachleute, dass es auf diesem Gebiet noch viele „Baustellen“ gibt. Der Landwirt mit seiner Erfahrung wird - zumindest vorerst - noch nicht durch Roboter ersetzt.