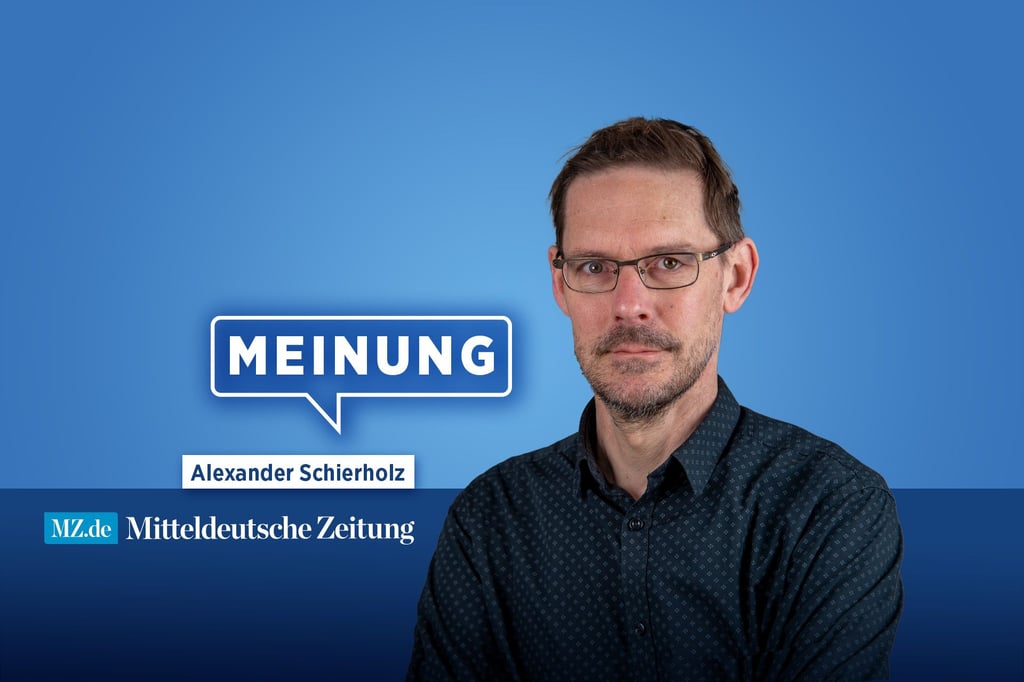Altbergbau Altbergbau: Last ohne Ende
Strenznaundorf/MZ. - Im Lärm, den der Motor seines Traktors machte, hörte Ökobauer Franz Schmidt das dumpfe Grollen unter seinen Reifen nicht. Der 44-jährige Landwirt wurde der großen Gefahr erst gewahr, als eine Wassersäule am Heck seines Traktors emporschoss. "Dick wie eine Bierflasche und vier bis fünf Meter hoch", berichtet Schmidt von den Geschehnissen auf einem Feld nahe des Dörfchens Strenznaundorf bei Könnern (Salzlandkreis). Die Fontäne versiegte zwar, doch als Schmidt kehrt machte, brach die Maschine bis zur Hälfte im Untergrund ein. "Ich habe die Tür gar nicht mehr aufbekommen."
Dabei hatte Schmidt noch Glück im Unglück: Außer einem Schrecken und einer Komplett-Dusche für den Traktor passierte ihm nichts. Seinem Nachbarn fehlt dafür nun ein gerüttelt Maß Ackerfläche: Auf der braunen Krume steht ein großer Teich, auf dem Saatgänse rasten und Schafe trinken. Die Tiere mögen den klaren Quell, der seit Dezember 2011 aus dem Berghang sprudelt. Denn er ist salzhaltig. Und bislang nicht zu stoppen.
700 bis 800 Liter pro Minute schießen derzeit aus dem Naundorfer Stollen, der zuvor seit Menschengedenken trocken lag. Es wäre noch mehr, würden nicht gut 500 Meter Luftlinie entfernt, kurz hinter dem Ortseingangsschild von Strenznaundorf, zwei mächtige Pumpen bis zu 200 Badewannenfüllungen pro Minute aus der Tiefe fördern. Jahrhunderte lang hatte niemand mehr Notiz davon genommen, was sich da unter einigen Dörfern im Salzlandkreis abspielte. Bis sich mit großem Knall die alten Erzgruben mit ihren Entwässerungstollen wieder in Erinnerung brachten.
Der vergessene Kupferschieferbergbau von Könnern ist in Sachsen-Anhalt kein Einzelfall, sondern beinahe Alltag, wie Bodo Carlo Ehling, Leiter der Abteilung Geologie im Landesbergamt, sagt. Nicht immer meldet sich der Bergbau so spektakulär zurück wie in Strenznaundorf. Aber fast immer ist dies verbunden mit einem immensen Aufwand, um Schäden zu beseitigen und neue zu verhindern.
Mühsame Arbeit
Hauer Marko Rühlke steht knietief im klaren Wasser. Es ist kalt und feucht und über Rühlke liegen gut 30 Meter Fels. Wer hier hinunter will, muss über steile Holzleitern - der Bergmann spricht von Fahrten - steigen. Ein abenteuerliches, anstrengendes Unterfangen. Unten angekommen wird es nicht einfacher: In mühsamer Handarbeit gräbt sich Rühlke gemeinsam mit zwei Kollegen durch den Schutt des Naundorfer Stollens. Wie ihre Kollegen vor Jahrhunderten nur mit Keilhaue und Schippe. Sprengstoff ist tabu - zum einen wegen der benachbarten Häuser im Dorf, zum anderen wegen der Gefahr, dass sich hinter dem Schutt eine Wasserblase befindet.
Die Männer arbeiten für die Bergbau-Spezialfirma BST Mansfeld aus dem Sangerhäuser Ortsteil Niederröblingen. Jenem Revier, wo zu DDR-Zeiten jahrzehntelang Kupferschiefer gefördert wurde. Um Kupferschiefer drehte sich auch jahrzehntelang alles in Strenznaundorf und dem benachbarten Könnern. Nur weiß das heute kaum noch einer. Um 1600 war hier am südlichen Ufer der Saale relativ spät mit dem Bergbau begonnen worden - im benachbarten Mansfelder Revier liefen die Gruben schon knapp drei Jahrhunderte. Den Dörfern an der Saale bescherten die kleinen Bergwerke einigen Wohlstand - aber auch fürchterlichen Gestank, wie Ehling weiß: "Die Schiefer-Platten enthielten Erdöl und wurden Übertage angezündet." Dieses Rösten des Erzes machte die Weiterverarbeitung einfacher. Der Sinn stand den Bergwerksbesitzer jedoch nicht nur nach dem namensgebende Kupfer, sondern vor allem nach dem ebenfalls im Erz enthaltenen Silber.
Während in einigen Teilen des von zahlreichen Klüften und Spalten durchzogenen Reviers bereits in der Mitte des 18. Jahrhunderts Schluss war - bei 100 Meter Schachttiefe waren die technischen Möglichkeiten der damaligen Zeit erschöpft - ging es etwa in Strenznaundorf noch gut 100 Jahre weiter. In dieser Zeit pickerte sich denn auch ein Teil der Bergleute mit Schlegel und Eisen voran Richtung Saale. In gut 30 Meter Tiefe entstand der Naundorfer Stollen, gut 25 Meter über dem Heinitzstollen. Beide sollten das in den Gruben anfallende Wasser nach Fertigstellung abtransportieren.
Bis in die 1930er Jahre hinein kümmerte sich ein Trupp der Mansfeld AG regelmäßig darum, dass das Wasser aus den Grubenbauen auch weiterhin seinen Weg ins Freie fand, sagt Bergamts-Geologe Ehling. Doch dann vernachlässigte man wohl den Service für die mit dem Begriff "Ewigkeitslasten" so treffend bezeichneten Bergbaurelikte.
Kein Einzelfall in dem auch an Entwässerungsstollen reichen Bergbau-Land Sachsen-Anhalt. Mit erheblichen Konsequenzen. "Seit den 1960er Jahren ging der Trödel hier in Strenznaundorf los", so Ehling. Es kam immer wieder zum Einsturz alter Schächte und sogenannten Tagesbrüchen - Löchern in der Erde, die in der Folge der Hohlräume in der Tiefe entstanden. Gott sei Dank sei nie etwas ernsthaftes passiert. Bis zum Dezember 2010. Da tat sich zwischen Trebnitz und Strenznaundorf ein zehn Meter tiefes und zwölf Meter großes Loch auf. Die Massen, die dabei im Untergrund verschwanden, verschütteten offenbar den Heinitzstollen. Das Wasser konnte nicht mehr in die Saale abfließen und suchte sich seinen Weg. Fast auf den Tag genau ein Jahr später war es dann Bauer Schmidt, der unfreiwillig die Erklärung dafür lieferte, wohin das Wasser verschwand.
Ausgang offen
Aus den bereits laufenden Erkundungsmaßnahmen im Strenznaundorfer Revier wurde so mit einem Mal eine Art Rettungsaktion. Die BST Mansfeld bohrte zunächst einen Erkundungsschacht. Dann begann der Job für Rühlke und Kollegen. Meter für Meter räumen sie Schlamm und Schutt der Jahrhunderte aus dem Stollen. Ziel der Maulwurfstätigkeit ist jene Stelle, an denen der Tagesbruch dem Wasser den Weg versperrt.
Was dann zu tun ist, ist noch offen, sagt Betriebsleiter Ronny König: "Wir wissen noch nicht, was uns noch alles erwartet, es ist noch kein Ende absehbar." 1,7 Millionen Euro haben die Sicherungsarbeiten bislang gekostet. Weil es für den historischen Bergbau keine Rechtsnachfolge gibt, ist in der Regel die Kommune für die Gefahrenabwehr zuständig. Land und EU helfen allerdings mit Fördermitteln. "Ziel ist, dass das Wasser künftig auf Dauer unter dem Ort abfließen kann", sagt Gerhard Jost, Altbergbau-Experte beim Bergamt.
Dann könnte auch Bauer Schmidt wieder gefahrlos seinen Acker bestellen. Und am besten mit Gurken. Denn in früheren Zeiten haben die Strenznaundorfer das Gemüse mit Wasser aus dem Bergbau eingelegt. Der Salzgehalt ist dafür ideal.
In der nächsten Folge lesen Sie, warum viele Bergwerke bis heute unbekannt sind.