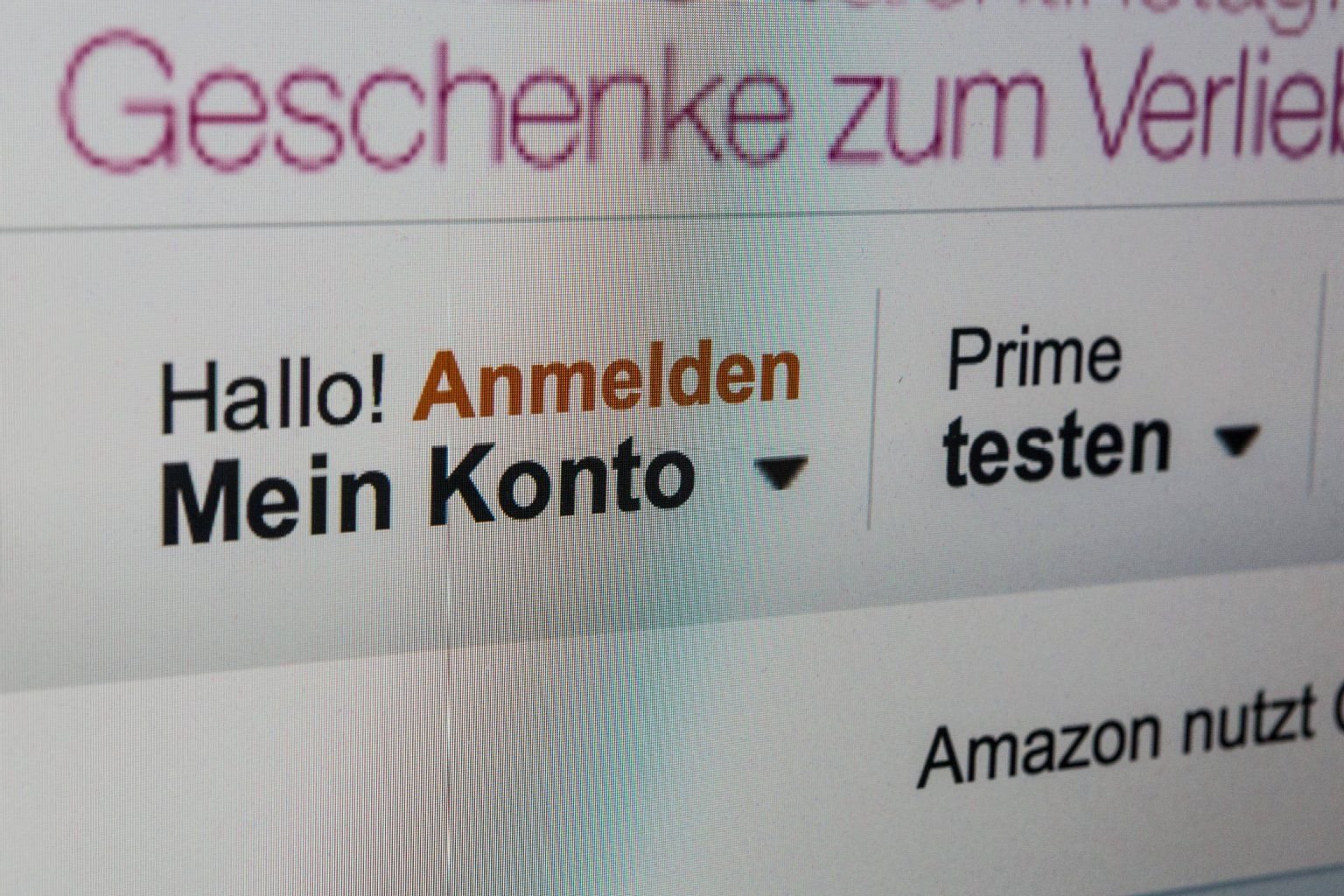Viele Rücksendungen Viele Rücksendungen: Wann darf Amazon ein Kundenkonto sperren?

„Ich habe letztens eine E-Mail von Amazon erhalten, dass ich in letzter Zeit zu viele Retouren gehabt hätte und sie wissen wollen, ob es irgendwelche Probleme mit meinem 'Einkaufserlebnis' gibt“, berichtet Kundin RedMoon im Amazon-Hilfeforum. Nun fürchtet sie eine Kontosperrung, wenn sie einen defekten Fön zurückschickt.
Beim britischen Programmierer Greg Nelson hat Amazon tatsächlich kurzen Prozess gemacht, wie der „Guardian“ berichtet: Nach 37 Rücksendungen bei 343 Einkäufen sperrte der Versandhändler Nelsons Konto. Aber wann darf ein Kundenkonto überhaupt gesperrt werden?
Rechtsexperte Christian Günther hat Antworten:
Im Geschäft vor Ort oder im Onlineshop: Wo wir was einkaufen, können wir inzwischen weitgehend wählen. Selbst Lebensmittel sind zunehmend online erhältlich. Ob Kunden zum Kauf einen Laden betreten oder dazu ins Internet gehen, wird Onlinehandel vom klassischen Einzelhandel weiterhin unterscheiden. Das wirkt sich auch darauf aus, wie und weshalb die Unternehmen ein eventuelles „Hausverbot“ erteilen können.
Wo verlaufen – online wie offline – die Grenzen, um Kunden auszusperren?
Sie kommen hier nicht raus
Hausverbot, das klingt auf Onlineshops bezogen etwas seltsam. Schließlich fehlen Online-Anbietern gerade Verkaufsräume, deren Betreten sich verbieten ließe. Auch sogenannte Showrooms, die manche Onlinegeschäfte zu ihrem Angebot unterhalten, ändern daran nichts. Denn meist ist dort nur Anschauen und Ausprobieren angesagt. Ein anschließender Verkauf erfolgt im Netz, wofür es wiederum eines Nutzerkontos bedarf. Wollen Online-Anbieter Kunden nicht als Käufer haben, sperren sie dieses oder verhindern die Registrierung.
So wird aus dem „Sie dürfen hier nicht rein“ im echten Verkaufsraum im Onlineshop ein „Sie kommen hier nicht raus“. Denn ohne Konto führt in vielen Webstores kein Weg durch die virtuelle Kasse. Die gerade zum Einkauf gedachte Seite lässt sich nicht wie vorgesehen nutzen. Aus diesem Grund stellt das „virtuelle Hausverbot“ in erster Linie ein Nutzungsverbot und kein Zutrittsverbot dar.
Hausverbot wurden Grenzen erteilt
Das Thema Kontosperrung im Onlineshop ist auch für Gerichte zumeist Neuland. Fälle zum altbekannten Hausverbot lassen jedoch Rückschlüsse auf Sperrungen in der Onlinewelt zu. Wegweisend war insofern ein 1993 vom Bundesgerichtshof (BGH) gefälltes Urteil (Az.: VIII ZR 106/93). Bis zu dieser Entscheidung waren Händler quasi Herrscher im eigenen Laden. Für ein Hausverbot galt die Devise: „Wer mir nicht gefällt, der darf schon nicht rein.“ Händler dürften ihre Kunden aufgrund der Vertragsfreiheit frei wählen.
Gründe für ein Hausverbot bedürfe es nicht. Das galt, bis eine Kundin in den 90er Jahren eine Taschenkontrolle verweigerte. Sie erhielt deshalb ein Hausverbot. Die Frau wollte das nicht akzeptieren. Der Fall ging bis zum BGH, der dem Marktbetreiber und damit auch der bisherigen Hausverbotspraxis Grenzen aufzeigte.
Ohne Fehlverhalten kein Hausverbot
Wer sein Geschäft allgemein allen Kunden öffnet, erklärt dem BGH zufolge, dass er an jeden verkaufen will, und verzichtet damit weitgehend auf sein Hausrecht. Kunden, die sich normal im Geschäft aufhalten, darf der Inhaber nicht mehr einfach den Zutritt verwehren. Für ein Hausverbot müssen schon handfeste Gründe vorliegen wie ein Verstoß gegen die Hausordnung oder die Störung von Betriebsabläufen wie das Begehen von Straftaten oder die Störung von Mitarbeitern.
Von einer solchen Störung des Geschäftsbetriebs ist bei einer verweigerten Taschenkontrolle allerdings nicht auszugehen, wenn den Kunden kein konkreter Diebstahlsverdacht trifft. Den Verdacht muss der Verkäufer im Streitfall beweisen, sonst ist das Hausverbot unwirksam. Auch ein Onlineshop müsse Beweise, z. B. für einen Verdacht auf Umtauschbetrug, erbringen.
Infos zu Umtausch-Rechten in der Fotostrecke:
Bloße Bitten reichen nicht aus
Daneben kann ein Hausverbot auch aufgrund von Verstößen gegen die Hausordnung ergehen. Für ein entsprechendes Nutzungsverbot im Onlineshop wäre ein Verstoß gegen dessen Nutzungsbedingungen erforderlich. Bei diesen handelt es sich in der Regel um Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB).
So finden sich gerade im Onlinehandel die Nutzungsbedingungen oft hinter dem Link „AGB“. In Geschäften vor Ort ist noch oft von der Hausordnung die Rede. Dafür müssen die jeweils aufgestellten Regeln aber deutlich machen, mit welchem Verhalten der Verkäufer nicht einverstanden ist. Auch das hat der BGH im Fall mit der Taschenkontrolle klargestellt.
Kunden hatte der Marktbetreiber darüber mit einer Hinweistafel informiert. Sie wurden höflich gebeten, ihre Taschen vorab an der Information abzugeben. Andernfalls verwies er höflich auf mögliche Taschenkontrollen. Das genügt laut BGH nicht – erst recht, wenn ein Betreiber wie bei einer Taschenkontrolle erheblich in Persönlichkeitsrechte eingreifen will.
Einer Bitte nicht Folge zu leisten, steht im Belieben des Kunden. Daher kann daraus auch kein Haus- bzw. Nutzungsverbot folgen. Empfehlungen oder Bitten ohne rechtliche Bedeutung können dem BGH zufolge keine allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sein.
Unerlaubtes Mitbieten auf eigene Auktionen
Ansonsten können die lapidar als das „Kleingedruckte“ bezeichneten AGB vielfältige Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Anbieter und Kunden haben und lassen sich bei Verstößen zur Begründung eines Haus- bzw. Nutzungsverbots heranziehen. Zum Schutz vor ungerechtfertigten Benachteiligungen müssen AGB jedoch besondere gesetzliche Anforderungen erfüllen.
Sie müssen insbesondere klar und verständlich sein. Auch von Grundgedanken gesetzlicher Regelungen lässt es sich mittels AGB nicht einfach abweichen. Welche Bedingungen ein Betreiber dabei als wichtig erachtet und aufstellt, hängt vom jeweiligen Geschäft ab und ist vorrangig seine Entscheidung.
So ging etwa das Landgericht Potsdam von einer rechtmäßigen Kontosperrung eines Auktionsportals aus, weil von einem Nutzerkonto auf eigene Angebote geboten wurde. Abgesehen von speziellen Geschäftsmodellen finden sich häufig Forderungen, mit den Zugangsdaten vertraulich umzugehen und bei der Nutzung die geltenden Gesetze einzuhalten.
Konto gesperrt wegen zu vieler Rücksendungen
Unter diesem Gesichtspunkt überschreiten Online-Anbieter, die Nutzerkonten aufgrund zu häufiger Rücksendungen sperren, selbst die gesetzlichen Vorgaben. Denn das Widerrufsrecht, das Verbrauchern bei Fernabsatzgeschäften zusteht, begrenzt die erlaubte Rückgabe bestellter Waren in keiner Weise.
Schließlich soll die Widerrufsmöglichkeit dazu dienen, die Ware wie im Geschäft vor Ort unverbindlich prüfen zu können. Ein Nutzungsverbot ließe sich darüber nicht begründen. Im Übrigen wäre eine entsprechende AGB unwirksam, da sie vom Grundgedanken einer gesetzlichen Regelung abweicht. Entscheidungen dazu fehlen jedoch bislang.
Gastautor Christian Günther ist Assessor und Redakteur bei anwalt.de.
(Bearbeitung: gs)