Büchergilde Gutenberg Büchergilde Gutenberg: Buchgemeinschaften führen Nischendasein
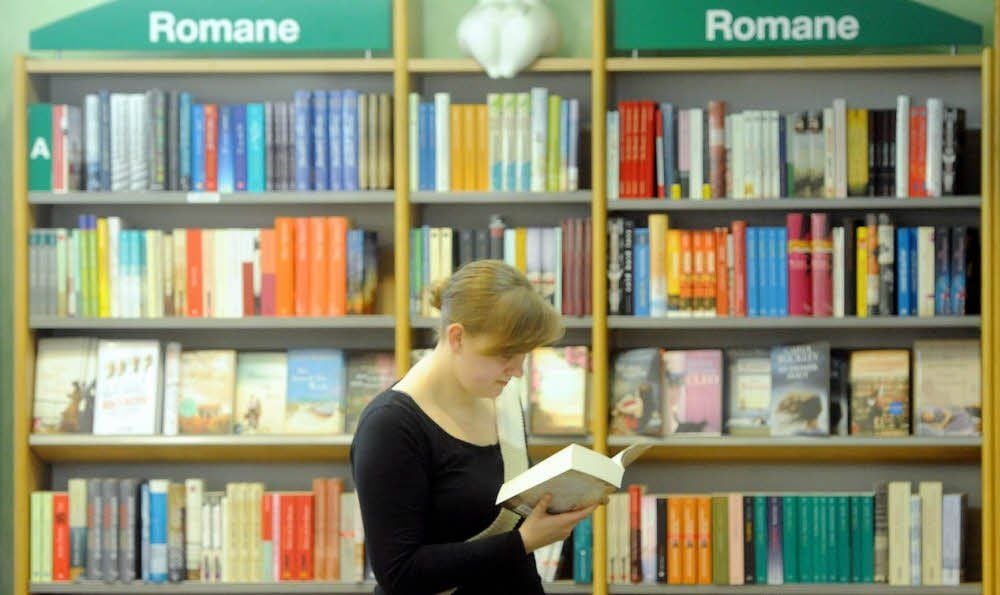
Berlin/MZ - Für manche sind sie längst lebende Fossilien der Medienbranche: die Buchclubs und Buchgemeinschaften. Dass sie dennoch eine Zukunft haben, beweist die Büchergilde Gutenberg. Sie bekommt gerade neuen Schwung. Denn jetzt steht fest: Künftig wird sie als Genossenschaft weitermachen.
Bertelsmann hingegen beendet das Kapitel Buchclub Ende nächsten Jahres und kappt damit seine Wurzeln – „wegen mangelnder wirtschaftlicher Perspektive“, wie der Medienkonzern mitteilt. Die Buchgemeinschaft ist eine Erfindung der 1920er Jahre, einst war sie stark mit politisch-weltanschaulichen Ambitionen verbunden. Büchergilde wurde 1924 vom Bildungsverband der deutschen Buchdrucker gegründet wurde. Als „Kulturinstitution der Werktätigen“ bezeichnete sie sich seinerzeit und verbreitete vor allem sozial engagierte Literatur. 1933 kam das Verbot durch die Nazis. Nach dem Krieg der Neuanfang.
1990 auf dem Höhepunkt
Zu dieser Zeit entwickelte Bertelsmann-Chef Reinhard Mohn eine neue Variante der Buchgemeinschaft. Ihm ging es nicht um Weltanschauung oder Volksbildung, sondern um das Vertriebsmodell: Mitglieder sind verpflichtet, regelmäßig Bücher zu kaufen. So lässt sich gut kalkulieren. Die Werke werden mit zeitlichem Abstand zum Original als Lizenzausgaben offeriert. Das macht große Auflagen, günstige Preise und zugleich ordentliche Renditen möglich.
Der Club war 1990 auf seinem Höhepunkt, als er allein in Deutschland sechs Millionen Mitglieder hatte. Danach ging’s bergab, das beschleunigte sich noch, als Amazon begann, den Buchhandel aufzumischen. Nun zieht der Konzern den Schlussstrich. Die letzte Filiale wird Ende 2015 am Stammsitz in Gütersloh dicht gemacht. Es gebe keine „tragfähige Perspektive mehr“, sagt Bertelsmann Manager Fernando Carro.
Die ersten Buchgemeinschaften und Buchclubs wurden im 19. Jahrhundert gegründet. Oft waren sie verknüpft mit religiös oder politisch orientierten Vereinen. Es ging darum, Mitglieder mit Literatur zur weltanschaulichen Orientierung zu versorgen.
Die erste Blütezeit war in der Weimarer Republik. Damals gab es ein knappes Dutzend größerer Buchgemeinschaften. Einen zweiten Boom erlebten sie nach dem zweiten Weltkrieg. Mit aggressiven Marketing- und Vertriebspraktiken wird Bertelsmanns Buchclub zum Branchenprimus.
Das Geschäftsmodell beruht darauf, Lizenzausgaben erfolgreicher Werke zu günstigen Preisen anzubieten. Mitglieder verpflichten sich, regelmäßig Bücher abzunehmen.
Mit dem Aufkommen von Bücher-Kaufhäusern in den 80er Jahren verlieren die Buchgemeinschaften an Attraktivität, zumal immer weniger Kunden bereit sind, sich auf die Abnahmeverpflichtungen einzulassen. Durch den Online-Buchhandel verlieren Buchclubs und Buchgemeinschaften zunehmend Marktanteile.
Auch die Büchergilde musste durch einige Krisen, hat sie aber erstaunlicherweise überstanden. Viele Jahre gehörte das Frankfurter Unternehmen zur Gewerkschaftsholding BGAG. 1998 wurde das Unternehmen dadurch gerettet, dass das Management das Unternehmen übernahm. Die Zähigkeit hat mit dem besonderen Konzept zu tun. Noch immer schimmert linkes Gedankengut durch. Es geht um anspruchsvolle Literatur, präsentiert in Form von handwerklich hochwertig gemachten Büchern, illustrierte Werke sind eine Spezialität. Dafür hat die Büchergilde schon viele Preise eingeheimst, sie selbst verleiht alle zwei Jahre einen eigenen Gestalterpreis.
Auf der nächsten Seite lesen Sie unter anderem etwas zu den juristischen Details.
Geschäftsführer und Verleger Mario Früh spricht von einer „Nischenstrategie“. Die gelte sowohl für die Lizenzausgaben als auch für die selbst verlegten Werke, für die es die Edition Büchergilde gibt. Doch Früh räumt auch ein: „Ich kann nicht verhehlen, dass das Geschäft schwierig ist.“ Um internationale Bestseller auf den deutschen Markt zu bringen, fehlt der Edition die finanzielle Kraft. Früh und seine Mitstreiter setzen deshalb darauf, gute Autoren zu entdecken, die hierzulande noch nicht bekannt sind. Das geschieht vor allem in der Reihe „Weltlese“, die von dem Schriftsteller und Essayisten Ilija Trojanow betreut wird.
Rückgrat der Büchergilde sind ihre rund 70 000 Mitglieder. Viele von ihnen werden künftig mitbestimmen. Im März fiel die Entscheidungen, die Büchergilde in eine Genossenschaft umzuwandeln. Das Ziel war, Leute zu finden, die insgesamt mindestens 300 Anteile à 500 Euro übernehmen. Das Ziel wurde dieser Tage erreicht. Früh wird nun seine Anteile an der Büchergilde an die Genossenschaft abtreten, genau wie die beiden anderen Gesellschafter der Büchergilde: Peter Schenk und Wolfgang Grätz – sie betreiben Partnerbuchhandlungen – noch eine Besonderheit. Davon gibt es mehr als 80, sie offerieren das Sortiment der Büchergilde stationär.
Juristische Details
Derzeit wird noch an den juristischen Details gebastelt, damit die Genossenschaft offiziell zum Eigner der Büchergilde werden kann. Für Früh, der Geschäftsführer bleiben wird, ist die neue Organisationsform die logische Konsequenz der Entwicklung der vergangenen Jahre. „Mit der Genossenschaft geben wir die Büchergilde in die Hände ihrer Mitglieder“, sagt er und fügt hinzu, dass es den neuen Genossen primär nicht um Rendite gehe. Vielmehr wollten sie bei der Programmgestaltung und bei allen wichtigen unternehmerischen Entscheidungen mitreden.
Die Konstruktion Genossenschaft soll erreichen, was für viele Unternehmen immer wichtiger wird: Bindung der Kunden. Bei der Büchergilde wird das gewissermaßen auf die Spitze getrieben. Kunden werden Eigentümer des Unternehmens. Früh hofft, so langfristig „die Existenz der letzten und einzigen Buchgemeinschaft“ hierzulande zu sichern.
Gute Bücher bleiben gefragt
Aber passt das noch in die Welt des Ex-und-Hopp-Lesen auf Smartphones oder E-Book-Readern? Für Früh gibt es da keinen Zweifel: „Gut gemachte Bücher sind noch längst nicht tot“, sagt der Geschäftsführer und Verleger ein bisschen trotzig. Er sieht sogar ein wieder „wachsendes Werte- und Qualitätsbewusstsein“, wenn’s um Lesen und Literatur geht – gerade auch bei jungen, gut ausgebildeten Menschen. Für diese Klientel sind Werke wie „Making Friends in Bangalore“ gedacht. Das ist ein ganz neues Genre, ein sogenannter Graphic Journey, ein Reisebericht in Buntstift-Skizzen, gezeichnet von dem Autor und Illustrator Sebastian Lörscher, von der Stiftung Buchkunst als eins der 25 schönsten deutschen Bücher 2014 ausgezeichnet, exklusiv für Mitglieder im Angebot der Büchergilde.





