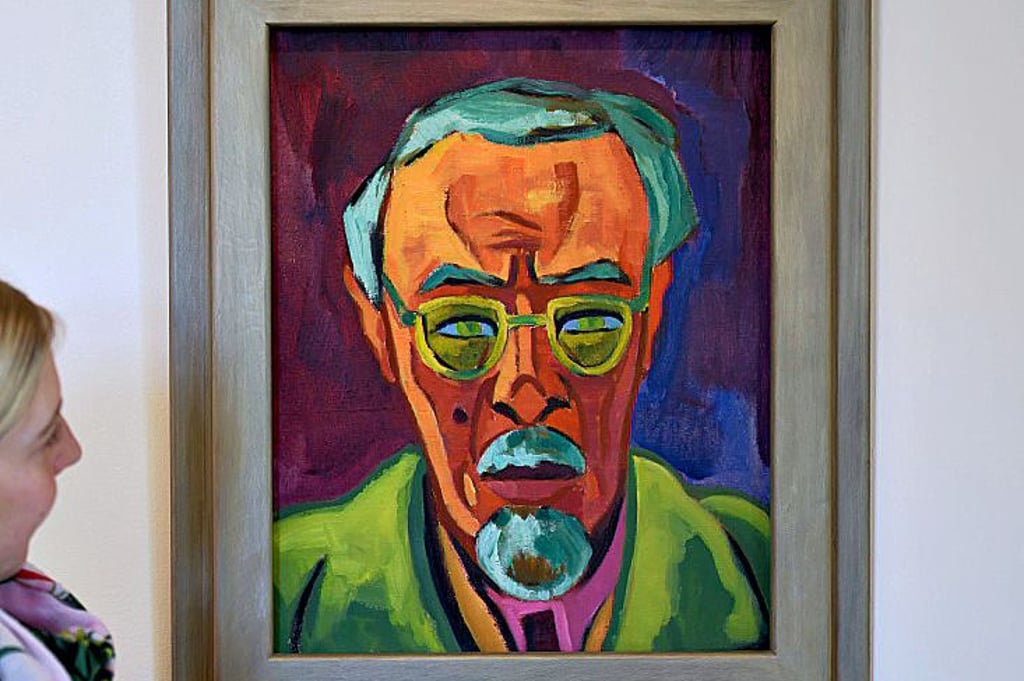700 Theorien zum Ort der Varusschlacht
Osnabrück/dpa. - Die Suche nach dem Schauplatz des grausamen Gemetzels zwischen Germanen und römischen Soldaten im September des Jahres 9 nach Christus beschäftigt die Deutschen seit vielen Jahrhunderten. Wo war die Varusschlacht?
Mehr als 700 Theorien versuchen, diese Frage zu beantworten. Den Streit um den historischen Ort haben auch jüngste archäologische Funde nahe dem niedersächsischen Ort Kalkriese nicht abklingen lassen. Dort, nördlich von Osnabrück, haben Forscher in den vergangenen Jahren den gewaltigen Schauplatz eines Kampfes freigelegt - das einzige römische Schlachtfeld aus dieser Zeit, das bislang entdeckt worden ist. Aber der Streit um den «wahren» Ort der Varusschlacht geht unvermindert weiter.
Nach antiken Quellen wurden die drei Legionen des Feldherren Quinctilius Varus in einem mehrtägigen Guerillakampf bei schlechtem Wetter in unwegsamem Gelände besiegt. Laut dem römischen Geschichtsschreiber Tacitus fand das Gemetzel im «Teutoburger Wald» statt, nicht weit von den Flüssen Ems und Lippe. Rasch wurde nach der Wiederentdeckung der Tacitus-Schriften im 16. Jahrhundert ein Höhenzug, der sich von Rheine bis vor die Tore Paderborns erstreckt, zum Teutoburger Wald umbenannt.
In dem Gebiet zwischen Lippe und Ems gebe es kaum einen Ort, «der bislang noch nicht als Schauplatz der Varus-Katastrophe in Betracht gezogen worden ist», schreibt der Tübinger Althistoriker Reinhard Wolters in seinem Buch «Die Schlacht im Teutoburger Wald». Zuvor, im Mittelalter, sei der Ort der Varusschlacht vor allem in der Nähe von Augsburg vermutet worden.
Die meisten Wissenschaftler akzeptieren mittlerweile Kalkriese zumindest als einen von möglicherweise mehreren Orten der Varusschlacht. Vor allem viele Hobbyforscher lehnen dies aber ab und scheuen im Streit auch nicht vor «harten Bandagen» zurück: So zeigte ein Freizeit-Geschichtsforscher mehrfach den Geschäftsführer des Varusschlacht-Museums Kalkriese bei der Staatsanwaltschaft an. Ein Heimatforscher aus dem Harz verortet die historische Schlacht bei Halberstadt und unterstellt wissenschaftlichen Kalkriese-Befürwortern, aus Karrieregründen unrichtige Angaben zu machen.
Solche Verbissenheit ist Albert Bömer, Kneipenwirt aus Rees am Niederrhein, nicht zu eigen. Von seinem Küchenfenster könne er Kalkar sehen und den Archäologischen Park Xanten, erzählt er. «Ich bin geschichtlich interessiert und ich bin fest in meiner Ortschaft verwurzelt», sagt der 48-Jährige. Er ist überzeugt, die Varusschlacht könne nicht bei Kalkriese gewesen sein, sondern in seiner Heimat. «Es muss in der Nähe des Rheins gewesen sein.» Auf einer Internet-Seite erklärt er seine Sicht der Dinge.
Es gebe Hobbyforscher, die durchaus mit der Wissenschaft zusammenarbeiten wollen, sagt Michael Zelle, der im Lippischen Landesmuseum Detmold Leiter eines Ausstellungsprojekt zum 2000. Jahrestag der historischen Schlacht in diesem Sommer ist. Gemeinsam mit dem Römermuseum in Haltern (Kreis Recklinghausen) und dem Varusschlacht-Museum Kalkriese würdigt das Landesmuseum das Jubiläum.
«Es gibt aber auch Leute, die nur das bestätigt bekommen wollen, was sie sowieso schon meinen, und das ist in der Regel eine Last für uns», betont Zelle. Viele glaubten, den Stein der Weisen gefunden zu haben. Das habe es schon immer gegeben. Seitdem es aber Kalkriese als möglichen Schlachtort gebe, eröffne das den Einzelkämpfern die Möglichkeit, «ihren ganzen Frust und Enttäuschung über das Nicht-Finden auf eine Institution abzuladen», meint der Archäologe.
«Da werden die aberwitzigsten Belege herbeigezerrt, die nach dem aktuellen Forschungsstand schon längst widerlegt sind», hat der Wissenschaftler beobachtet. Das werde aber nur «sehr bedingt akzeptiert»: «Dann wird immer der Antagonismus "Amtsarchäologie" gegen die wahre Varus-Forschung aufgebaut.»
Die wissenschaftliche Forschung habe ihre eigene Methodik, betont Rudolf Asskamp, Leiter des Römermuseums in Haltern: «Jemand, der das nicht studiert hat, hat die normalerweise nicht.» Vor der Entdeckung Kalkrieses musste er sich als junger Wissenschaftler mit der These eines Freizeitforschers namens Wilhelm Leise beschäftigen. Dieser Autor habe in den 1980er Jahre die Theorie aufgestellt, die Varusschlacht sei nicht im Teutoburger, sondern im Arnsberger Wald (Sauerland) geschlagen worden.
Archäologische Belege habe Leise keine gehabt, betont Asskamp. Aber überregionale Medien hätten das Buch Leises so populär gemacht, dass der Landschaftsverband Westfalen-Lippe sich damit beschäftigen musste. «Ein wissenschaftliches Kolloquium wurde einberufen, bei dem damals alle Theorien Leises in Bausch und Bogen verdammt wurden», blickt Asskamp zurück.
Dabei sind sich eigentlich alle Wissenschaftler einig, dass die Frage nach dem Ort der Schlacht unerheblich ist. «Wichtig ist die politische Entwicklung nach der Schlacht», sagt Asskamp. Wie hat der römische Staat auf die furchtbare Niederlage reagiert? Die Erforschung dieser Frage habe aber gar nichts mit der umstrittenen Örtlichkeit der Varusschlacht zu tun.