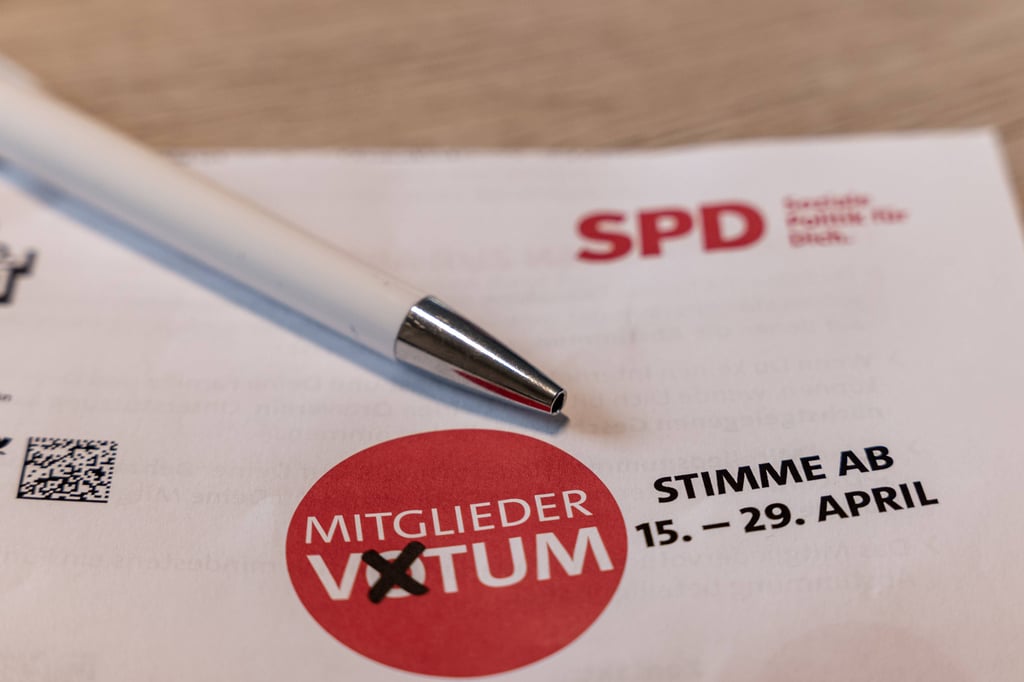Völkerschlacht Völkerschlacht: Historisches Getöse auf einer Wiese

Markkleeberg/MZ. - Rums! Der Knall aus den Kanonen ist ohrenbetäubend. Schwarzpulvergeruch liegt in der Luft, der Qualm trübt die Sicht auf Artillerie und Infanteristen. Die Druckwelle des Kanonenfeuers ist dutzende Meter weiter zu spüren. Irgendwo in den Zuschauerreihen murmelt einer: „Die Kanoniere müssen damals alle taub gewesen sein.“ Damals, das war im Oktober 1813, als sich in Leipzig Napoleons Truppen und die Alliierten Österreich, Preußen, Russland und Schweden in der bis dato größten und blutigsten Feldschlacht der Weltgeschichte gegenüberstanden. 100000 Menschen starben, tausende wurden verletzt. Noch heute finden Archäologen auf Baustellen in und um Leipzig immer wieder Massengräber, Zeugnisse der Völkerschlacht.
199 Jahre später sind wieder Truppen da. 1500 Mann, auf einer Wiese in Markkleeberg. Sie lagern in Biwaks, bevor es in die Schlacht geht. Inklusive zivilem Gefolge, das wie Hökerweib Andrea kleine Tüten „Kanonenfutter“ feilbietet: Nüsse, Mandeln, ein patriotischer Spruch und ein paar Musketenkugeln. Im normalen Leben ist Andrea Linnenbröker aus Nordrhein-Westfalen Kauffrau. Damals wäre sie wohl eine Bürgerliche gewesen, glaubt sie. Kein Hökerweib, das die Nacht im Zelt verbracht hat, auf Strohsäcken. Und natürlich ohne Taschenlampe, weil das nicht authentisch wäre.
Eintauchen in die Geschichte, so nennt der Verband „Jahrfeier Völkerschlacht bei Leipzig“ das dreitägige historische Spektakel, dessen Höhepunkt eine Gefechtsdarstellung mit diesmal 1500 Akteuren ist. Ein Spielplatz für groß gewordene Jungs, Kriegsspielerei? Mitnichten, betonen die Organisatoren. „Wenn man Augenzeugenberichte von damals liest, kann man sich nicht vorstellen, wie das war“, sagt Verbandschef Michél Kothe. Hunger, Kälte, unbequeme Uniformen. Ein Leben, in dem ein Baumstumpf zum Sitzen reicht, die einfachste Suppe lecker ist, man nicht mal eben die Heizung aufdrehen kann. „Darum geht es: So weit in die Geschichte einzutauchen, dass man sie wirklich versteht. Nicht die Weltgeschichte, sondern die des Einzelnen“, sagt Kothe - selbst Sohn zweier Geschichtslehrer.
Authentizität gehört dazu. „Sehen Sie ihn“, sagt Kothe und zeigt auf ein Mitglied der französischen Marinegarde. 100 Knöpfe zieren seine Uniform, jeder davon kostet zwei Euro. „Manche brauchen Jahre, um ihre Ausrüstung komplett zu haben.“ Tonpfeife oder filterloses Zigarillo ersetzen moderne Kippen. Und im „Stab“ erzählen Kommandeure und Majore von der gemeinsten Frage, die man heute auf dem Schlachtfeld stellen kann: „Herr Major, wie spät ist es?“ Wer jetzt auf sein linkes Handgelenk sieht statt zur Taschenuhr zu greifen, ist nicht tief drin im Früher.
Seit den 1980ern wird mit einer Darstellung jährlich an die Völkerschlacht bei Leipzig erinnert. Bei Schnee sind sie hier schon gewesen, haben bei minus zehn Grad im Freien geschlafen. Vor 199 Jahren hat es geregnet. Diesmal sind es über 20 Grad und Sonnenschein - „viel zu schönes Wetter“, sagt Kothe. Die 5000 Zuschauer stört dieser Makel wenig, und Moderator Gert Pfeifer gelingt es im Getöse von Musketenschüssen, Kanonendonnern und Schlachtbefehlen auf beiden Seiten mühelos, seine Zuhörer zurückzuversetzen. In eine Zeit, in der Leipzig mit 30000 Einwohnern völlig überfordert war von einer guten halben Million Soldaten, etlichen schwer Verwundeten. In eine Zeit, aus der eine Geschichte von einem Berg von Gliedmaßen vor der Thomaskirche erzählt - „eine Amputation dauerte damals drei bis vier Minuten“.
Es gibt viele Geschichten aus jener Schlacht. Doch: „Es sind fast alles Mythen, was wir über diese Zeit zu wissen glauben.“ Die das sagt ist eine, die gerade 20000 Seiten Fachliteratur gewälzt hat: Bestseller-Autorin Sabine Ebert, bekannt von ihren mittelalterlichen Hebammen-Romanen. Im März 2013 kommt ihr neuer Roman zur Völkerschlacht heraus. Er ist einer der Höhepunkte im Jahr des 200. Jubiläums der Völkerschlacht und des 100. des Völkerschlacht-Denkmals. Auch die Gefechtsdarstellung im Oktober wird dann viel größer sein: Mehr als 3000 Darsteller haben sich schon angemeldet, mit 5000 rechnen die Organisatoren. Selbst aus den USA und Kanada werden Historien-Fans dabei sein.
Diesmal kommen sie aus elf europäischen Ländern, Männer und Frauen, die nicht einfach schießen, wie sie sagen, sondern auch forschen. Auf Events wie in Leipzig werde er vielleicht von 100 Menschen fotografiert, erzählt Torsten Schellhorn aus Erfurt in der Uniform der königlich-sächsischen Leibgarde. „50 davon fragen mich nach historischen Ereignissen.“
Anders als 1813 werden Napoleons Truppen indes diesmal nicht entscheidend geschlagen. Das Gefecht endet mit einem Patt, mit dem gemeinsamen Plaudern am abendlichen Lagerfeuer. Es gibt keine Sieger, keine Verlierer. „Vor knapp 200 Jahren undenkbar“, sagt einer. Heute nicht - auch das sei eine Botschaft des Spektakels.