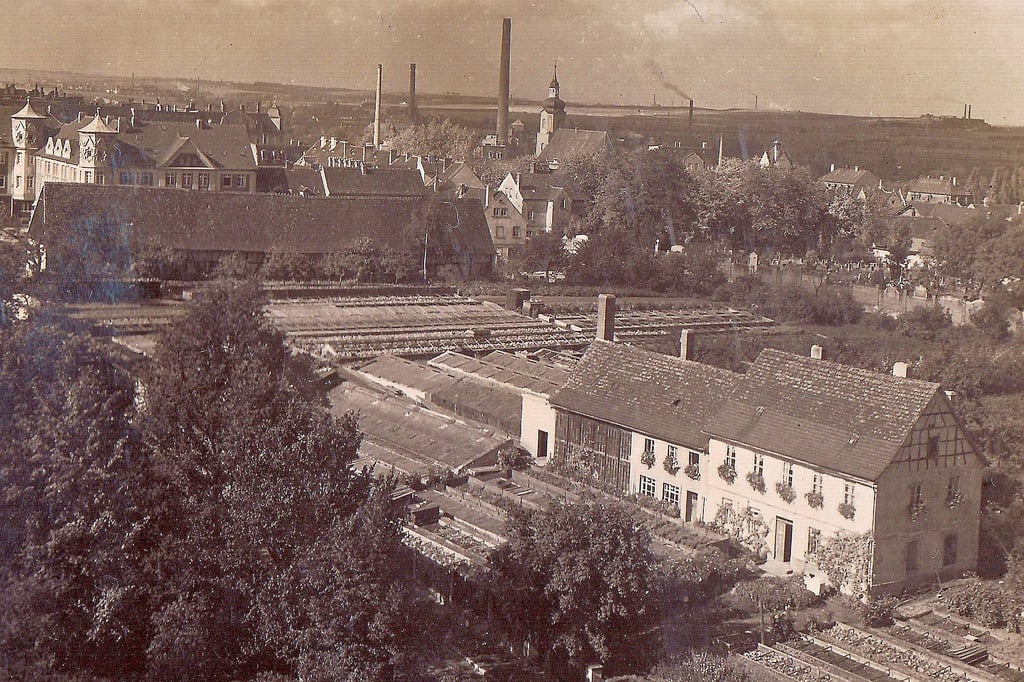Kinderbuch von Wilhelm Busch feiert Geburtstag Kinderbuch von Wilhelm Busch feiert Geburtstag: Max und Moritz in Zeitz

Zeitz - Wer kennt sie nicht, die sieben Streiche von Max und Moritz? Witwe Bolte, Schneider Böck, Lehrer Lämpel und vielen anderen Dorfbewohnern machten die Lausbuben das Leben schwer. Das ging so lange gut, bis sie vom Bauer Mecke auf frischer Tat erwischt wurden und letztendlich samt Getreide in der Mühle zermahlen wurden. Das Kinderbuch endet so - sehr brutal - mit dem Tod der beiden Missetäter.
Max und Moritz Reime auf Kommando
Die MZ hat sich anlässlich des 150. Geburtstages des Buches über Max und Moritz einmal umgehört und gefragt, wie präsent die beiden Kinderbuch-Lausbuben heute noch sind. Einen ganz besonderen Bezug zu Max und Moritz hat Bianca Sonnenschein. Als sie erfuhr, dass sie Zwillinge bekommt, stand fest, es wird mindestens ein Junge und der sollte Max heißen. Das andere Kind versteckte sich und verriet sein Geschlecht nicht. Erst in der 18. Woche stand fest, es wird auch ein Junge. „Ach egal, wenn ich schon einen Max habe, kann ich den anderen auch Moritz nennen“, dachte sie sich und setzte genau das in die Realität um. Heute sind die beiden Rabauken vier Jahre alt und machen ihrem Namen alle Ehre. „Wir hören ständig, dass Max und Moritz absolut passend ist, denn die beiden sind wirklich Lausbuben“, lacht Mutter Bianca Sonnenschein. Die Zwillinge wissen genau, warum sie so heißen und sagen auf Kommando die Reime von Wilhelm Busch: „Max und Moritz diese beiden wollten sich die Haare schneiden...“ Dabei grinsen sie über das ganze Gesicht und wissen genau, dass sie damit die Lacher auf ihrer Seite haben.
Auch Tina Daniel muss lachen, wenn sie von Max und Moritz hört. „Klar, kenne ich die“, sagt sie und muss dabei sofort an ihren siebenjährigen Sohn Florian denken. „Der versteckt immer Sachen und behauptet dann, er war es nicht“, sagt Daniel schmunzelnd, wissend, dass es Florian sehr wohl war. Trotz der teils bösen Streiche von Max und Moritz bleibt das Werk von Wilhelm Busch für die 34-Jährige ein Kinderbuch und gehöre in jeden Haushalt mit Nachwuchs.
Frischen Nachwuchs in Form einer Enkelin gibt es bei Margit Zaum aus Kretzschau. Auch bei ihr steht „Max und Moritz“ im Bücherregal und wird auf jeden Fall irgendwann der Enkelin übergeben. Streiche hat die 63-Jährige nie gespielt - abgesehen von ein paar Lappalien. Sie erinnert sich aber noch ganz genau an eine Gemeinheit ihrer Kollegen. „Mir wurden ganz viel Büromaterialien in die Handtasche gesteckt. Als ich zu Hause ankam, hab ich mich gewundert, warum die so schwer ist. Da waren Locher und Lineale drin“, erinnert sich Zaum heute an die Neckerei.
Die Bubengeschichte in sieben Streichen ist eine Bildergeschichte des deutschen humoristischen Dichters und Zeichners Wilhelm Busch. Sie wurde Ende Oktober 1865 erstveröffentlicht und zählt damit zum Frühwerk von Wilhelm Busch. Viele Reime dieser Bildergeschichte wie „Aber wehe, wehe, wehe! Wenn ich auf das Ende sehe!“, „Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich“ und „Gott sei Dank! Nun ist’s vorbei - mit der Übeltäterei!“ sind zu geflügelten Worten im deutschen Sprachgebrauch geworden. Die Geschichte ist eines der meistverkauften Kinderbücher aller Zeiten und wurde bis heute in 300 Sprachen und Dialekte übertragen.
Wilhelm Busch zog es während seines Kunststudiums in Düsseldorf und Antwerpen nach München, wo er es fortsetzte. Kontakte zur dortigen Kunstszene fand Busch im Künstlerverein Jung-München, in dem nahezu alle wichtigen Maler zusammengeschlossen waren und für deren Vereinszeitung Busch unter anderem Karikaturen und Gebrauchstexte verfertigte. Kaspar Braun, der die satirischen Zeitungen Münchener Bilderbogen und Fliegende Blätter verlegte, wurde dadurch auf Busch aufmerksam und bot ihm schließlich eine freie Mitarbeit an.
Später schloss er sich dem Verlag von Heinrich Richter an. Dieser lehnte Anfang 1865 das Manuskript von Max und Moritz wegen mangelnder Verkaufsaussichten ab. Am 5. Februar 1865 wandte sich Wilhelm Busch an Kaspar Braun. Kurz danach sagte er zu und bat ihn, kleine Dinge zu überarbeiten. Im August 1865 zeichnete Wilhelm Busch in München die Geschichte auf Holzdruckstöcke, und im Oktober 1865 kam die Bildergeschichte mit einer Auflage von 4000 Exemplaren heraus. Der Verkauf dieser ersten Auflage mit einem Einband aus schlichter, heller Pappe zog sich bis 1868 hin. Für ein Exemplar dieser Erstauflage wurden im Jahr 1998 auf einer Auktion umgerechnet 125 000 Euro bezahlt.
Etwas weniger Glück hatte Daniel Oettel. Bisher unbekannte „Täter“ haben ihm eine brennende Papiertüte mit Hundekot vor die Tür gestellt. „Das hat echt widerlich gerochen“, meint er und verzieht dabei das Gesicht, als ob er den Geruch noch in der Nase hat. Max und Moritz sind ihm und seiner Freundin Christiane Schröder sehr bekannt. Eine Ausgabe der Buben steht sogar irgendwo im Regal.
Die Streiche der beiden Figuren von Wilhelm Busch sind keineswegs aus der Luft gegriffen. Sie orientieren sich an der Kindheit des Dichters und Zeichners und spiegeln seine eigenen Streiche wider, die er gemeinsam mit seinem besten Freund spielte. Dass es aber nicht nur Lausbuben, sondern auch Mädels gibt, die ordentlich Unfug treiben, beweist Carmen Nietsch eindrucksvoll.
Nicht nur, dass sie ihrem Ex-Freund die Stuhlbeine heimlich angesägt hat, weil er sie nach Strich und Faden belogen hat, nein, Carmen Nietsch hat ihrem ehemaligen Nachbarn sogar die Hühner geklaut, getötet und genüsslich verspeist. „Als mein Nachbar seine Viecher durchzählte, merkte er natürlich, dass welche fehlten und schob es auf den Fuchs. Ich war raus als Übeltäter“, amüsiert sich Carmen Nietsch noch heute. Damals fand sie das alles witzig, heute ist sie raus aus dem Streiche-Alter. Max und Moritz waren ihr also gute Vorbilder und auch heute liest sie gern noch mal in das Buch hinein.
„Früher waren doch Streiche normal. Klingelputzen haben wir doch alle gespielt“, verrät Rainer Tombrock. Für ihn waren diese jedoch übersichtlich. Selbst, wenn das tragische Ende der beiden Freunde sehr brutal wirkt, sei es für Trombrock zu Recht ein Kinderbuch.
Es gibt eine Berufsgruppe, die auch heute noch regelmäßig mit Streichen zu tun hat. Heute wie früher. Die Lehrer. Das weiß auch Beate Kümmel, Schulleiterin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Wenn sie Max und Moritz hört oder sieht, muss sie gleich schmunzeln. Die Streiche der Schüler haben sich allerdings nicht geändert. „Da werden das Lineal oder die Uhr einfach so ausgerichtet, dass die Sonne lustig an der Wand reflektiert und damit die halbe Klasse belustigt. Als Physiklehrerin kann man da natürlich sogar noch einen Nutzen ziehen und dazu was erklären“, sagt Kümmel.
Weil Streichespielen irgendwie auch nie aus der Mode kommt, werden wohl die Geschichten von Max und Moritz auch nie vergessen werden und von einer Generation zur nächsten weitergetragen. (mz)