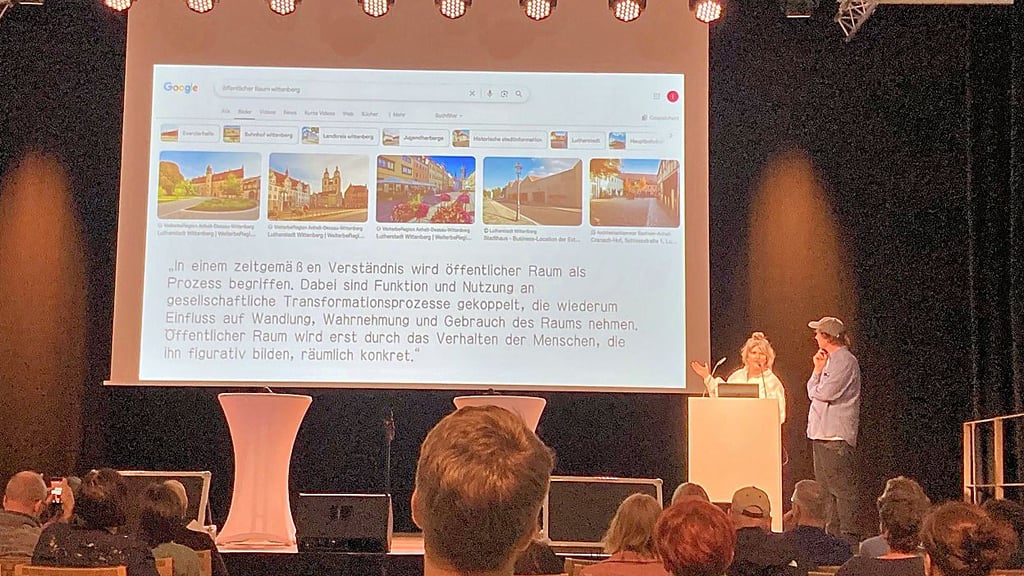Jessen Jessen: Eingebaute Sohlschwellen haben Fließtempo gedrosselt
JESSEN/MZ. - Dabei ging es unter anderem um mögliche Renaturierungsmaßnahmen. Zu große Erwartungen bei der Präsentation im Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft dämpfte Flussbereichsleiter Jörg Herrmann: "Was der Mensch in mehreren Generationen gestaltet hat, kann nicht in einer Generation wieder gut gemacht werden."
Das wurde auch in der Arbeit von Thomas Schumann deutlich, der sich mit den Laufmusterveränderungen des Flusses beschäftigt hatte. Die daraus resultierende Strömungsenergie sei dafür verantwortlich, wie viel Ufer- oder Sohlenmaterial abgetragen wird. Für seine Untersuchungen hatte er Karten von 1850, 1904, 1953 und 2007 digitalisiert und "übereinander gelegt". Dabei wurden nicht nur die Begradigungen durch den Menschen gut sichtbar. Es war auch erkennbar, dass einige Mäander wanderten. Außerdem hatte er ermittelt, dass sich die Länge des Flusslaufes im Altkreis Jessen zwischen 1904 und 1953 um zwölf Kilometer verkürzt hatte. 29 Kilometer sind übrig geblieben. Die Sinuosität (Verhältnis der Länge des Flusslaufes zur geraden Linie) ist dabei von 1,64 auf 1,16 gesunken. Als mögliche Renaturierungsmaßnahmen sieht Thomas Schumann die Öffnung der Deiche, die Anbindung der Altarme und die Unterstützung der Ufererosion.
Er erläutert aber auch die Schwierigkeiten, die er sieht. Bei einer Deichöffnung stehe die Frage, wie weit sich das Überschwemmungsgebiet erstrecken soll. Ohne einen neuen Schutz wäre es seiner Meinung nach möglich, wenn es gelingt, die Auenkante zu ermitteln und sie als natürlichen Deich zu nutzen. Allerdings habe er diese mit dem ihm vorliegenden Kartenmaterial nicht finden können. Auch das Einbeziehen der Altarme sei problematisch. Während sich das Flussbett durch die Tiefenerosion in die Landschaft eingegraben hat, bewahrten die Altarme das alte Niveau. Dort seien zudem Konflikte mit dem Naturschutz zu erwarten. Erfahrungen beim Fördern der Ufererosion wurden bereits gemacht, zum Beispiel durch das Installieren mehrerer Hakenbuhnen (die MZ berichtete). Die sich im Verlaufe von Jahren einstellende leichte Mäandrierung soll das Fließtempo herabsetzen, das Wasser länger in der Region halten.
Es gibt schon Untersuchungen, wo außerhalb von Siedlungsräumen etwas an den Deichen getan werden kann, ergänzte Flussbereichsmeister Frank Beisitzer. Doch deren Öffnung sei langwierig, sie müsse Schritt für Schritt vorgenommen werden. Bei den Altarmen sei zumindest ein Beströmen bei entsprechenden Hochwasserlagen durchaus denkbar, meinte er weiter. Worte, die Günther Erfurt, Sprecher der Hegegemeinschaft "Schwarze Elster", sicher gern gehört hat. Er wies noch einmal darauf hin, dass das Wasser zu schnell wieder weg sei, vermutet aber auch, dass wohl kaum jemand freiwillig Land hergeben würde für eine Deichverlegung. Zudem verwies er darauf, dass er schon vor einigen Jahren mit Dr. Thomas Vetter, dem Betreuer der beiden Studenten, über solche Studien gesprochen habe, sie damals jedoch am Widerstand von Dr. Jörg Hartmann, Fachdienstleiter Umwelt in der Wittenberger Kreisverwaltung, gescheitert seien. Im Brandenburgischen wäre man schon viel weiter, erklärte Günther Erfurt.
Mit den Querprofilen des Flusses hatte sich Andy Vogel in seiner Arbeit befasst. Dabei stieß er jedoch auf Schwierigkeiten, diese exakt einem Flusskilometer zuzuordnen. Zunächst wurden sie von der Quelle aus und später beginnend an der Mündung gemessen. Trotzdem konnte er in der ihm zur Verfügung stehenden Zeit (23 Wochen für Recherchen, Auswertung und Schreiben der Arbeit) sechs Profile untersuchen und vergleichen. Dabei wurde deutlich, dass sich der Fluss stark eingegraben hat. Es handelt sich um ein Sandbettgewässer mit Kiesanteilen. Charakteristisch für ein Vorhaben zur Herabsetzung der Fließgeschwindigkeit sei der Einbau von Sohlschwellen, der sich bewährt habe. Diese hätten zumindest bewirkt, dass sich die Querschnitte nur gering geändert haben. Als Schlussfolgerung aus seinen Untersuchungen regte Andy Vogel an, die Querschnitte wegen der besseren Vergleichbarkeit immer an den gleichen Stellen zu messen und auffällige Stellen öfter zu untersuchen. Messungen am Unterlauf wären ebenso nötig, aber dort gebe es kein Vergleichsmaterial. Für Jörg Herrmann waren die vorgelegten Zahlen interessant. Sie seien ein Erkenntniszuwachs, auf dem aufgebaut werden könne. Viele kleine Schritte bei der Renaturierung würden irgendwann ein großer sein. Wenn die Schwarze Elster annähernd ihre alte Länge erreicht habe, wären vermutlich die Sohlschwellen nicht mehr vonnöten. "Wir haben noch genügend Acker für künftige Arbeiten." Dem pflichtete Thomas Vetter bei und sagte weiter Unterstützung zu.