Geschichte in Wittenberg Geschichte in Wittenberg: Spuren des Jüdischen in der Lutherstadt
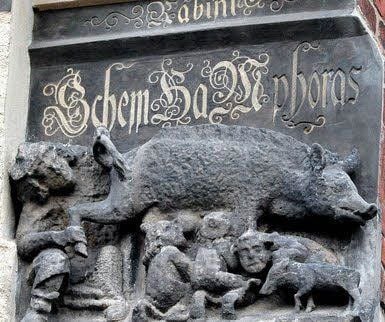
Wittenberg - „Wir halten noch ein paar Fäden der Erinnerung in der Hand“, sagt Ulrich Bosse, „die nächste Generation ist aber schon darauf angewiesen, dass wir ihnen unser Wissen weiter geben“.
Der Enkel von Käthe Bosse war 2009 nach Wittenberg gekommen, um bei der Verlegung eines Stolpersteins für seine Großmutter dabei zu sein. 27 dieser Gedenksteine gibt es mittlerweile in Wittenberg. Ebenerdig in das Pflaster eingelassen, erinnern die per Hand beschrifteten Messingsteine an das Schicksal jüdischer Wittenberger im Nationalsozialismus.
„Hier wohnte Käthe Bosse, geb. Levin, Jahrgang 1886, verhaftet 21.7.1944 Zuchthaus Halle, deportiert 1.11.1944 Ravensbrück, ermordet 16.12.1944.“, steht auf der Platte für Käthe Bosse in der Heubnerstraße, die der Initiator des Projektes Günter Demnig (siehe auch „Engagiert und ausgezeichnet“) wie immer selbst verlegt hat.
55 000 Mal hat er das mittlerweile getan, in 1 600 Orten, in zwanzig Ländern Europas. Das Projekt gilt inzwischen als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Es löste eine Welle historischer Forschungen an unterschiedlichsten Orten aus.
In der Lutherstadt hatten Renate Gruber-Lieblich, Reinhardt Pester und Mario Dittrich die Aufgabe übernommen, vor Ort die Erinnerung auszugraben, wiederzubeleben, wachzuhalten (die MZ berichtete). Grundlegende Quelle war für sie ein Buch des Wittenberger Historikers Ronny Kabus, das den Titel „Juden der Lutherstadt Wittenberg im III. Reich“ trägt.
Nachfahren ausfindig gemacht
In alten Archiven sowie in neuen elektronischen Medien haben die drei inzwischen weiter recherchiert, Biographien beleuchtet und nicht zuletzt Nachfahren der einstigen Wittenberger ausfindig gemacht. Dass von den Familien und ihrem Schicksal im Rahmen des Projektes mehr in Erinnerung bleibt als die dürren Daten zu Geburt und Tod auf den Stolpersteinen, ist nicht zuletzt ihnen zu verdanken. „Geschichte wieder lebendig werden zu lassen, das ist für mich eine reizvolle Aufgabe“, bekennt Reinhard Pester. Besonders berührend seien für ihn Begegnungen mit den Nachfahren der Verfolgten. In Tel Aviv hat er Ruthie Friedman besucht, eine Enkelin des Wittenbergers Richard Hirschfeld, der im Jahr 1939 nach Palästina emigrierte. Obschon in Israel geboren, spreche Ruthie Friedman noch deutsch - „und in einigen Worten hört man noch den Wittenberger Klang“, berichtet Pester.
Eine Menge anrührender Eindrücke
Man könne gar nicht beschreiben, wie sehr sich die Nachfahren freuten, dass das Schicksal ihrer Familie nicht vergessen werde und dass es vor Ort Ansprechpartner gebe, unterstreicht er. Ausreisedokumente, Kinderfotos, Zeugnisse und eine Menge anrührender Eindrücke hat Pester von der Reise mitgebracht. Es sind nicht zuletzt solche Begegnungen, die ihn motivieren, die durchaus aufwendige Recherchearbeit fortzuführen.
Was alles im Laufe der Jahre ausgegraben wurde, wollen die Hobbyforscher nun einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Sie arbeiten an einer Broschüre, in der sämtliche Wittenberger Stolpersteine aufgelistet und die Geschichten der Menschen erzählt werden sollen. 64 Seiten stark, mit einem Stadtplan, in dem die Steine markiert sind soll das Bändchen „Menschen, die auf den Spuren des jüdischen Wittenberg wandeln, etwas in die Hand geben“, beschreibt der Verwaltungsangestellte Pester seine Beweggründe für die Herausgabe der Publikation im Drei-Kastanien-Verlag.
Geplanter Erscheinungstermin ist der Herbst 2016. Dann wird die Liste 29 Steine umfassen. Zwei neue Messingquader für Joseph Preminger und Berta Wiener-Sand können die Initiatoren bis dahin verlegen, dank weiterer Recherchen und dank der Spenden des Koordinierungszentrums Deutsch-Israelischer Jugendaustausch Con-Act sowie einer Privatperson aus dem Ruhrgebiet. Er selber, bekennt Reinhard Pester, habe beim Gang durch die Stadt entlang der Stolpersteine inzwischen manchmal das Gefühl, „Menschen zu besuchen.“ (mz)






