Baugeschichte von Schloss Lützen Baugeschichte von Schloss Lützen: Kleine Burg im Blickfeld
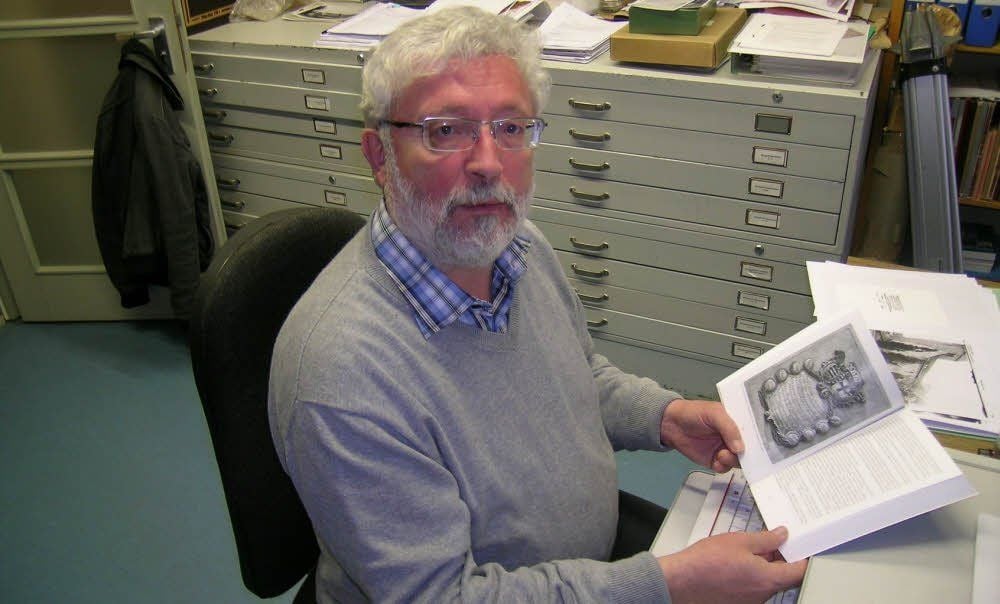
Lützen - „Es war eine spannende Arbeit“, blickt Reinhard Schmitt zurück. Was er meint, das sind seine Forschungen zur Baugeschichte des Lützener Schlosses. Die Ergebnisse der umfangreichen Recherchen sind jetzt in einem Beitrag des neuesten Heftes der Landesgruppe Sachsen-Anhalt der Deutschen Burgenvereinigung nachzulesen.
Auf mehr als 500 Seiten hält das Heft Nummer 23 der Deutschen Burgenvereinigung eine bunte Mischung von Beiträgen bereit, die sich inhaltlich von Israel über Thüringen bis hin zu zahlreichen Burgen und Schlössern in Sachsen-Anhalt erstreckt. Reinhard Schmitt schreibt auch über die Baugeschichte der Eckartsburg. Das Heft gibt es unter anderem in Buchhandlungen in Halle und Weißenfels. Informationen zur Burgenvereinigung sowie Bestellung des Heftes unter www.deutsche-burgen.org.
Bereits seit 1992 gibt die Landesgruppe eine eigene Schriftenreihe unter dem Titel „Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt“ heraus. Jedes Jahr erscheint eine neue Ausgabe. „Unser erstes Heft hatte rund 80 Seiten. Mittlerweile sind unsere jährlichen Publikationen international anerkannt und geachtet. Das nunmehr 23. Heft hat einen Umfang von rund 530 Seiten“, berichtet Schmitt, der als Sachgebietsleiter Bauforschung im Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Halle arbeitet.
Seit vielen Jahren befasst sich der gebürtige Hallenser mit Burgen, Schlössern und Klöstern, vor allem im Süden Sachsen-Anhalts. Neuenburg, Schönburg, Schloss Goseck oder Burg Querfurt - da kennt sich der Archäologe aus. Maßgeblich kümmert sich Schmitt im Laufe des Jahres um die Vorbereitung eines jeweils neuen Heftes der Burgenvereinigung. „Mittlerweile hat sich ein Stamm von Autoren herausgebildet“, berichtet Schmitt.
Auflage von 1.000 Exemplaren
Eine wichtige Quelle seien zum Beispiel Abschlussarbeiten von Universitäten. Junge Leute erhielten somit die Möglichkeit, ihre Arbeiten zu publizieren und sich in der Fachwelt bekannt zu machen. Mit den Autoren arbeiten, Beiträge redigieren, eigene Beiträge recherchieren und schreiben - da steckt Schmitt jede Menge Arbeit hinein ehe wieder eine dicke Broschüre in einer Auflage von 1.000 Exemplaren auf dem Tisch liegt. Im deutschsprachigen Raum warten 150 Abonnenten auf das neue Heft, das jeweils zum Jahresende herauskommt. Zu kaufen ist die Broschüre in verschiedenen Buchhandlungen, unter anderem in Halle und Weißenfels. Rund 10.000 Euro kostet die Herausgabe eines neuen Jahreshefts. Neben den Einnahmen aus dem Verkauf finanziert es sich dank Unterstützung der Sparkasse und des Landes.
Mehr zum neuen Heft und welche interessanten Entdeckungen bei den Nachforschungen gemacht wurden, lesen Sie auf Seite 2.
Im neuesten Heft, das auf der Mitgliederversammlung der Landesgruppe Ende vergangenen Jahres in Lützen vorgestellt wurde, nimmt nun die Baugeschichte des Lützener Schlosses einen wichtigen Platz ein. Da lenken bereits die Fotos auf der Umschlagseite den Blick auf den markanten Lützener Bau. Im Inneren präsentiert Reinhard Schmitt auf mehr als 110 Seiten seine Erkenntnisse in Text und Bild. „Das ist die erste systematische und komplexe Darstellung der Baugeschichte des Lützener Schlosses“, sagt stolz der 64-Jährige, der mehr als ein halbes Jahr lang an dem Beitrag gearbeitet hat.
Dabei war es einigermaßen schwierig, die einzelnen Bauphasen jener gotischen Burganlage genau zurück zu verfolgen, die heute für sich in Anspruch nimmt, den kleinsten Schlosshof Deutschlands zu beherbergen. Irgendwann in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts sei die Burg errichtet worden, so Schmitt. Seitdem sei viel verändert und erneuert worden, was heute nur noch zum Teil nachvollziehbar sei.
Armen- und Zuchthaus war geplant
Und doch hat Schmitt bei seinen Nachforschungen einige interessante Entdeckungen gemacht. So ist er auf eine Serie von Grundrissen aus dem Jahr 1771 gestoßen. Diese belegen, dass die Regierung des Stifts Merseburg zu dieser Zeit im Lützener Schloss ein Armen- und Zuchthaus errichten wollte. Ein Vorhaben, das jedoch nie in die Tat umgesetzt wurde. Interessant aus heutiger Sicht auch, dass das Schloss einstmals ein zweites Obergeschoss und ein Dachgeschoss mit Kupfer bedeckten Erkern hatte. Im Jahr 1831 ließ der damalige private Eigentümer beides abbrechen.
Schmitt lässt ebenso nicht unerwähnt, dass der Lützener Magistrat Ende 1844 zwei Zeichnungen des Schlosses an Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. geschickt hat. Dass der Herrscher Anfang 1845 höchstpersönlich ein Dankesschreiben gesendet hat, dürfte die Lützener Stadtväter durchaus mit Stolz erfüllt haben. „Im Vergleich zu anderen Anlagen der Region hat das Lützener Schloss wohl eher eine bescheidene Bedeutung. Doch hat es der Bau allemal verdient, seine wechselvolle Geschichte näher zu beleuchten“, zieht der Autor schließlich sein Fazit. (mz)





