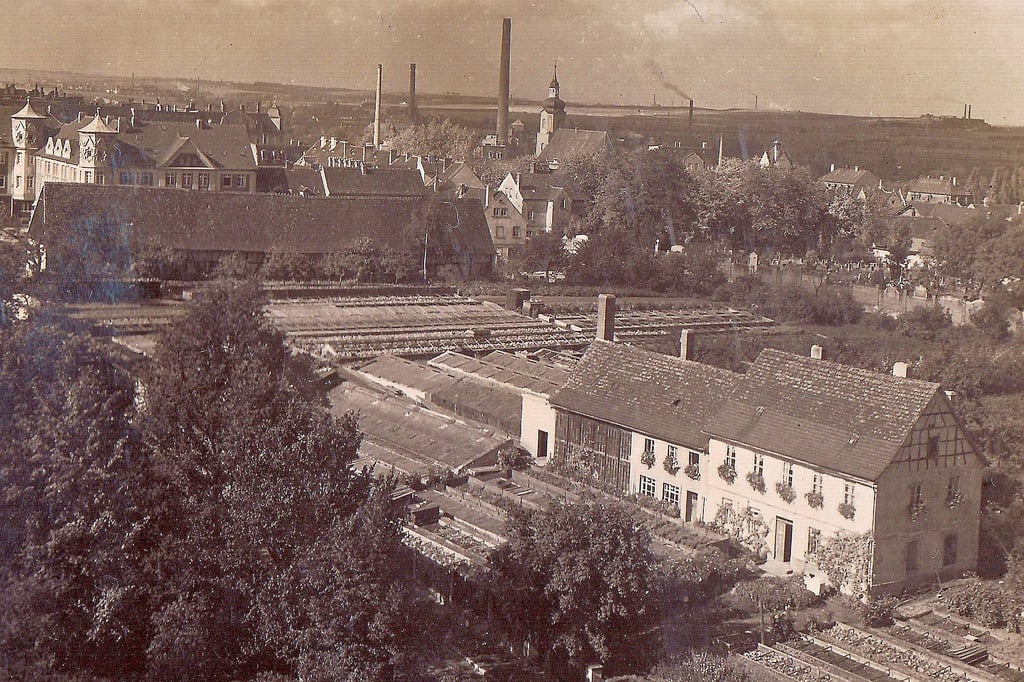Köthen Köthen: «Detektiv» auf der Spur eines Uhrmacher
köthen/MZ. - Den Zettel mit den noch zu lösenden Aufgaben hat Jan William Howard nicht so weit weggeschoben. Eben so weit, dass er greifbar ist, als die Frage nach den Recherche-Lücken auftaucht. So sehr der Köthener Historiker und Museumsmitarbeiter auch geforscht hat - ein Ende ist nicht abzusehen: Noch ist es nicht gelungen, die ganze Geschichte der dem Köthener Museum gehörenden Bodenstanduhr aus der Werkstatt von Johann Rudolf Fischer aufzuklären. Und dennoch hat das Museumsgespräch am Sonntag in beeindruckender Weise gezeigt, was man alles herausfinden kann, wenn man sich nur tief genug in der Geschichte versenkt.
Und dafür ist die Bodenstanduhr, die in der Bachgedenkstätte ihren Platz hat, ein signifikantes Beispiel. Eben weil die Ausgangsposition für die Geschichtsforschung so denkbar schlecht war. 1993, vor nicht einmal 20 Jahren, wusste man im Köthener Museum über den Hofuhrmacher Johann Rudolf Fischer und seine Bodenstanduhr(en) buchstäblich nichts. Eines Tages, so erinnert sich Howard, schneite der Brief eines Mannes herein, der in der Nähe von Koblenz wohnte und dem Museum eine Bodenstanduhr von Fischer zum Kauf anbot - mit dem Hinweis , die Uhr habe zum Besitz des Köthener Schlosses gehört. "Da waren wir baff", sagt Howard - denn niemand kannte Fischer.
Da man aber damals sehr bemüht war, für die geplante Bach-Gedenkstätte originale Ausstattungsstücke aus dem Schloss aufzutreiben und und man auch noch mehr Geld für Anschaffungen hatte, wurde die Uhr gekauft. "Sie war teuer", erinnert sich Howard, ohne Preise zu nennen: "Das macht man nicht."
Bei aller Freude über das schöne Stück, merkte man im Museum bald, dass man nicht nur den Kaufpreis, sondern auch Lehrgeld bezahlt hatte. "Wir hätten", so Howard, "uns einen Kostenvoranschlag machen lassen sollen für die Restaurierungskosten." Die nämlich erwiesen als erheblich: Etwa ein Drittel des Kaufpreises musste dafür aufgewendet werden, die Defekte der Uhr zu beseitigen.
1994 / 95 wurde die Uhr restauriert. Das Gehäuse mit den intarsierten Initialen des Köthener Fürsten August Ludwig wurde in Dessau wieder hergestellt, das Uhrwerk in Dresden bei der Firma Lang, die nach der Wende vom ehemaligen Chefrestaurator des mathematisch-physikalischen Salon in Dresden gegründet worden war. Bei Lang mussten 60 Teile neu angefertigt werden - und dabei fehlt der Uhr nach wie vor ihr Spielwerk. Im Unterschied zu einem Fischer-Pendant in Mosigkau, für das eine Walze erhalten ist, die u.a. den "Dessauer Marsch" spielt.
Schon während der Restaurierung wurde Howard vom damaligen Museusmdirektor Günter Hoppe beauftragt, auch etwas über den Uhrmacher Fischer herauszufinden, dessen Leben in ein völliges Dunkle gehüllt war. Howard suchte. Und wurde fündig. Ermittelte hier einen Zusammenhang, fand dort ein Puzzleteil. In einem Auktionskatalog von 1816, in dem 1 148 Stücke aus dem Köthener Schloss angeboten wurden, zum Beispiel die Position 757 "Spieluhr nebst Gehäuse und 15 Walzen, die Harfe fehlt". Das, denkt Howard, könne die Köthener Uhr gewesen sein. In den Kirchenbüchern von Sankt Jakob gab es die ersten Spuren des Uhrmachers. Im Taufregister wurde unter dem 14. Februar 1738 von der Taufe der ersten Tochter Fischers gesprochen.
Und nicht nur das: Der Name seiner Frau, Henriette Elisabeth Buschberger, tauchte ebenso auf wie die einigermaßen erstaunliche Information, dass Fürst August Ludwig höchstselbst als Pate der Fischer-Tochter Charlotte Juliane aufgeführt wurde. Dazu kamen noch andere hochrangige Personen als Paten. Fischer wird hier schon "hochprivilegierter Uhrmacher" genannt, später bringt er es gar zum Fürstlichen Hofuhrmacher.
Die Taufregistereinträge geben auch späterhin Auskunft über das gesellschaftliche Umfeld, in dem sich Fischer bewegte. So viel wird klar: Er hat in Köthen Karriere gemacht und quasi - per Privileg - die Monopolstellung als Uhrmacher erhalten. Er hat die Stadtuhr, die sich damals an einem Turm von St. Jakob befand, jahrelang gewartet. Er hat hier seine erste Frau nicht nur geheiratet, sondern auch beerdigt. Er hat sich ein weiteres Mal verehelicht, mit Anna Orsell, der Tochter eines Seidenfabrikanten aus dem französischen Dijon. Er ist insgesamt zehnmal Vater geworden.
Im Todesjahr von August Ludwig von Anhalt-Köthen geht Fischer nach Potsdam, wo er Königlich-preußischer Hofuhrmacher unter Friedrich II. wird. Mit 100 Talern Jahresgehalt. Fischer, der um 1713 in Basel geboren ist, stirbt am 30. Juni 1778 in Potsdam.
Howard hat, auch in den Akten des Stadtarchivs, viel Interessantes über Fischer zusammengetragen. Am Ende angekommen ist er noch nicht. Fragen bleiben: Wo hat Fischer in Köthen gewohnt? Ist er mit der sächsischen Uhrmacherdynastie Fischer verwandt? Was hat eine Fischer-Uhr gekostet? Da hat der Mann aus dem Museum in den nächsten Jahren noch einiges an Recherche-Arbeit vor sich. Und vielleicht gibt es dann erneut ein Museumsgespräch zu einem der schönsten Stücke im Historischen Museum.