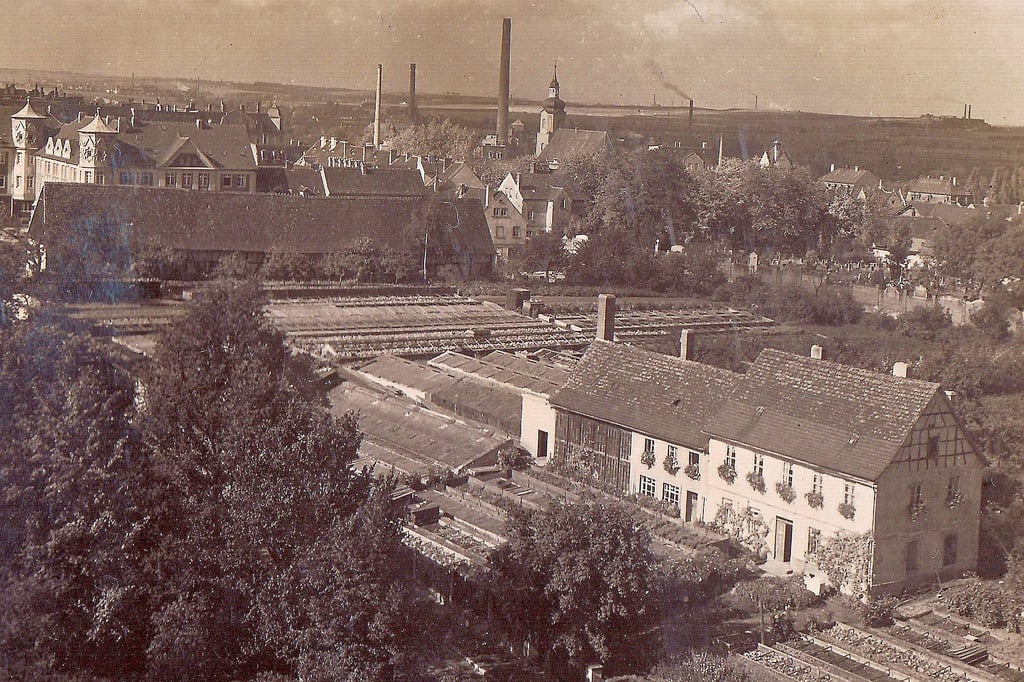Amalgam im Zahn Amalgam im Zahn: Umweltbelastung soll reduziert werden

Seyda - Mit der EU-Quecksilberverordnung ist die zahnärztliche Verwendung von Amalgam seit dem 1. Juli eingeschränkt. Schwangere und Kinder unter 15 Jahren, erst recht mit Milchzähnen, dürfen keine quecksilberhaltigen Füllungen mehr bekommen. „Dahinter steht vor allem die Absicht, die Umweltbelastung durch das giftige Quecksilber zu reduzieren“, erklärt Zahnarzt Dr. Herbert Kleine, der in Seyda praktiziert.
Denn nach wie vor sei nicht erwiesen, dass das in der Zahnmedizin verwendete Amalgam langfristige gesundheitliche Schäden hervorruft. „Es sind viele unspezifische Symptome, die auch andere Ursachen haben können“, so der Zahnarzt. Seit der Jahrtausendwende lebe die Diskussion darum intervallartig auf. „Daran haben Wissenschaftler geforscht. Wenn sie eindeutige Belege gefunden hätten, wäre es längst verboten“, sagt der 61-Jährige.
Erweiterung bei Kindern
Bewiesen sei aber, dass Menschen mit Amalgamfüllungen erhöhte Quecksilberwerte im Urin haben. Das komme durch jahrelangen mikrofeinen Abrieb. Auch in anderen Körperregionen reichere sich Quecksilber an. Nicht nur, dass es über Ausscheidungen ins Abwasser und in die Umwelt gelangen könnte - man müsse, so Kleine, bis zum Ende denken: Der Mensch nimmt das Amalgam mit ins Grab.
„In Deutschland ist das schon seit Jahren weitgehend Standard“, sagt der Zahnarzt zu den nun geltenden gesetzlichen Einschränkungen. Nur dass das Alter der Kinder bislang auf sechs Jahre beschränkt war. Und noch eine weitere Bestimmung, die ab 1. Januar 2019 EU-Gesetz wird, ist in Deutschland schon seit 1995 Norm: Das Dentalamalgam darf nur noch in verkapselter Form verwendet werden.
Amalgam ist ein metallurgischer Begriff. Er steht für die Vereinigung mehrerer Metalle mit Hilfe von Quecksilber. Je geringer der Quecksilbergehalt, um so fester wird die Masse. Für Dentalamalgam, oder auch Silberamalgam genannt, wird hauptsächlich Silber-Zinn-Feilung verwendet. Der Quecksilbergehalt beträgt maximal drei Prozent. Schon im siebenten Jahrhundert soll „silberner Teig“ in China als Zahnfüllung verwendet worden sein. Anfang des 19.Jahrhundert setze sich die Füllung mit Zinn als Hauptbestandteil durch. Bis in die 1950er Jahre war Kupferamalgam üblich, weil es aber nicht so beständig war und die Herstellung umweltschädlich, wurde es durch Silberamalgam abgelöst.
„Früher hat das Personal mit einem Spatel etwas von den Spänen in den Mörser gegeben, mit der Pipette Quecksilber darauf geträufelt, das ganze vermischt und dann in einem Lederläppchen verknetet“, erzählt Kleine. Das Giftigste beim Quecksilber sind die Dämpfe. Die Gefährdung für die Zahnmedizinischen Assistenten und den Doktor war also ungleich höher als für Patienten.
Heutzutage wird die potenzielle Füllmasse in Kapseln geliefert, verschiedene Größen für verschiedene Dosierungen, aber die Zutaten sind noch durch eine hauchdünne Folie voneinander getrennt. Diese wird geöffnet, wenn die Kapsel in den Automaten eingespannt wird, der den winzigen Behälter mit hoher Geschwindigkeit rüttelt, so dass die Masse gebrauchsfertig entnommen werden kann.
Als Vorteil der Amalgamfüllung nennt der Zahnarzt die gute Verarbeitungsfähigkeit, auch wenn der Untergrund feucht ist. „Die Masse härtet schnell aus, sie ist sehr langlebig und hoch belastbar.“ Der Kaudruck betrage nämlich mehrere hundert Kilogramm. „Und man kann sie sehr glatt polieren“, erklärt der Mediziner.
Letzteres sei wichtig, um die Anhaftung von Bakterien zu verhindern. Das bekannte Missgefühl, wenn man mit Aluminium an die Füllung kommt, sei eine elektrolytische Reaktion infolge der Leitfähigkeit der Metalle.
Teure Entsorgung
Bei der Behandlung fallen allerdings Reste an. Unter dem Becken an der Seite des Behandlungsstuhls verbirgt sich ein Filtersystem mit einem Amalgamabscheider. Der Schlamm wird in einer Kapsel aufgefangen, die der Praxisinhaber als Sondermüll entsorgen lassen muss. „Das ist richtig teuer“, sagt Kleine.
Amalgam als Füllung im Seitenzahnbereich bleibt also außer für den oben genannten Personenkreis die Standardleistung, die die Krankenkassen bezahlen. Die teurere Alternative sind laut Hebert Kleine Composite-Füllungen. „Das sind Gemische aus feinsten Glaskeramik-Partikeln, die mit Kunststoffkleber vermischt sind.“ Gehärtet werden diese mit UV-Licht.
Wegen des höheren Aufwandes - die zu behandelnden Stellen müssen absolut trocken sein und der Zahnarzt braucht spezielles Modellierwerkzeug - ist es kostenintensiver und die Krankenkassen übernehmen diese Leistung nur dort, wo man die Defekte sehen würde.
Zementfüllungen - „das sind Gemische aus Silikaten und Säuren“ - seien nicht so stabil und könnten im Unterschied zu Silberamalgam nicht so glatt poliert werden. „Sie werden als Unterfüllung gemacht oder als kurzfristige Lösung.“
Dr. Kleine hält die durch die EU-Verordnung vorgegebene Richtung für vernünftig. „Ich würde auf Amalgam jetzt schon gern ganz verzichten“, sagt der Zahnmediziner. In der Praxis merke er nämlich bereits deutlich, dass der Trend davon weggehe.
Die Patienten seien informiert und erkundigen sich von sich aus nach Alternativen. „Eigentlich ist die Amalgamfüllung bei uns schon fast die Ausnahme“, sagt er. (mz)