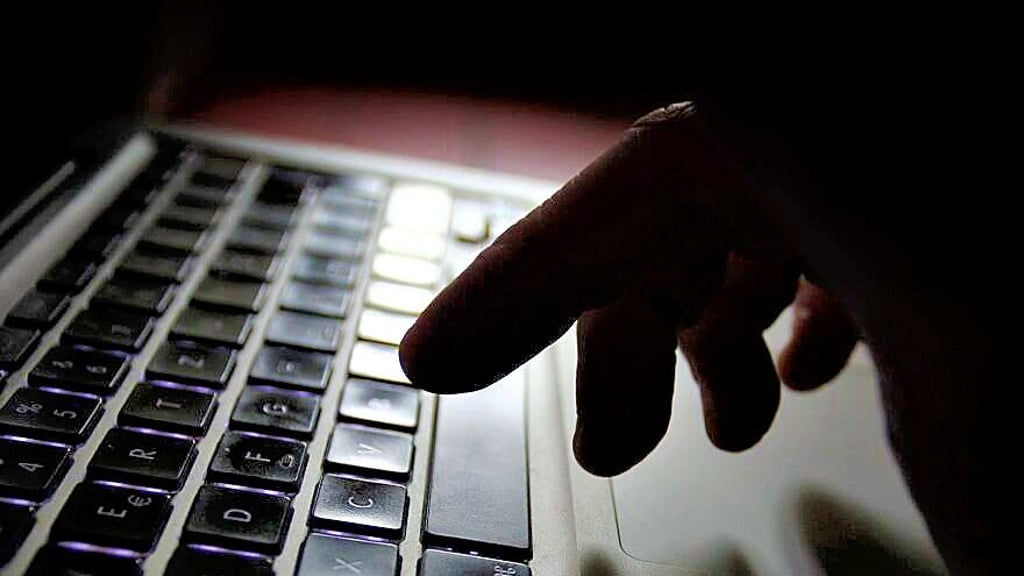Podiumsdiskussion mit Günther Krause Podiumsdiskussion mit Günther Krause: Den Vertrag machte der Osten

Aschersleben - „Ich kann die Frage, was man am Einigungsvertrag hätte besser machen können, nicht mehr hören“, macht Günther Krause, der den Vertrag seitens der Noch-DDR ausgehandelt hat, sich Luft. Er zählt eine lange Liste von Paragrafen auf, die schlichtweg nicht umgesetzt wurden. „Es wurde 25 Jahre zu wenig mit dem Vertrag gearbeitet. Die Politiker sind nicht in der Lage, das Recht für die Ostdeutschen durchzusetzen.“ Günther Krause hält den Vertrag hoch: „Der enthält 5500 Regelungen. Nur 3000 davon sind umgesetzt.“
Der heutige Unternehmer und Experte für biogene Verfahrenstechnik nimmt den Hefter mit der 18. Ausführung des Einheitsvertrages und reicht ihn durch die Reihen des Hörsaales der Fachhochschule Polizei. Deren Rektor Frank Knöppler hatte den ehemaligen DDR-Staatssekretär und späteren bundesdeutschen Verkehrsminister eingeladen. „Das passt bestens in unser Lehrgebiet Staats- und Verfassungsrecht“, sagt er ins Auditorium. Wohlwissend, vor ihm sitzen jene, die zumeist nach der historischen Wende geboren wurden. „Manchem mag das wie ,erzähl mir mal was von früher’ klingen, aber das war ein Einschnitt in der deutschen Geschichte. Daher freue ich mich, mit Professor Krause einen Protagonisten jener Zeit begrüßen zu können.“
Der referiert professionell, man spürt dessen bis in die DDR-Zeit zurückreichende Praxis als Hochschullehrer, plaudert aus dem Nähkästchen, als rede er das erste Mal darüber, lässt seine Worte hart werden, wenn es darum geht, dass seine Lebensleistung beschädigt werden soll. Viele der jungen Studenten und Auszubildenden hörten hier ganz andere Töne als im schulischen Geschichtsunterricht, von jemandem, der hautnah dabei war. Als Verhandlungsführer der DDR beim Einheitsvertrag. Er stellt klar, den Vertrag haben die Ostdeutschen gemacht. „Es gab zwar ein Ministerium für innerdeutsche Beziehungen, aber die glaubten nicht an die Einheit und hatten ebenso wenig Konzepte wie wir.“ Nicht vergessen sollte man aber den ersten Staatsvertrag über die Wirtschafts-, Sozial- und Währungsunion. Da zog man die Notbremse, sonst wären weitere Menschen der D-Mark hintergelaufen. Er erinnere sich gut an eine Demonstration von Genossenschaftsbauern 1990 auf dem Alex in Berlin. „Bestimmt 65 000 standen da und pfiffen mich aus. Als ich wieder im Büro war, zählte ich zwölf Einschläge von Tomaten und zehn von Eiern auf meinem Anzug.“
Mit Blick auf die deutsche Einheit räumt er mit der Mär der Souveränität auf. „Es gab zwei Länder, die mitnichten souverän waren. DDR und BRD wurden von den vier Mächten am 2. Oktober 1990 in ihre Souveränität entlassen, um sich am 3. Oktober zu vereinigen.“ Dem Osten würde es ohnehin besser gehen, zeigt sich Krause überzeugt, wenn die Abgeordneten der neuen Länder im Bundestag, nur 20 Prozent aller gewählten Mitglieder, untereinander einig wären. Krause lobt die deutsche Einheit, stellt aber auch klar: „Wer die Augen zu macht, sieht auch nichts blühen.“
In einer Diskussion in der Fachhochschule erinnerten sich auch Pröpstin i.R. Dorothee Mücksch, Bundestagsabgeordnete Heike Brehmer und der letzte Magdeburger Polizeichef und heutige Polizeidirektor Rigo Klapa an das Jahr 1990. Mücksch stellte klar, dass die kritischen Geister der DDR-Bürgerbewegung „nicht holterdiepolter“ die Einheit anstrebten. Sie erinnere sich aber noch an die Euphorie der damaligen Zeit. „Mir fehlt heute die Begeisterung, mal wieder die Nächte durchzuarbeiten.“
Auf die Rolle der Sowjetunion in der Vereinigungsphase angesprochen, schlug der in der Ukraine unternehmerisch tätige und von Embargos gebeutelte Krause schnell den Bogen zu heutigen Konflikten. Er dürfe auf der Krim nicht investieren, die Krise dort bringe ihm 70 Prozent Unsatzeinbußen. Putin agiere geschickt, fordere einen Wirtschaftsraum von Lissabon bis Wladiwostok. Das Volk vertraue ihm in der Angst, noch einmal vom Westen überrollt zu werden.
Günther Krause ermutigt die künftigen Polizisten zum Standpunktzeigen. „Ich habe die Sorge, dass Sie genötigt werden, Einheitsmeinungen zu äußern. Die Diskussion von Unterschiedlichem führt zum Ergebnis.“ Es dürfe daher keine Benachteiligung geben, wenn unangenehme Dinge abseits der Standardmeinungen geäußert werden. (mz)