Bildungs-Experte Interview: Warum sind Jungs in der Schule oft schlechter als Mädchen?
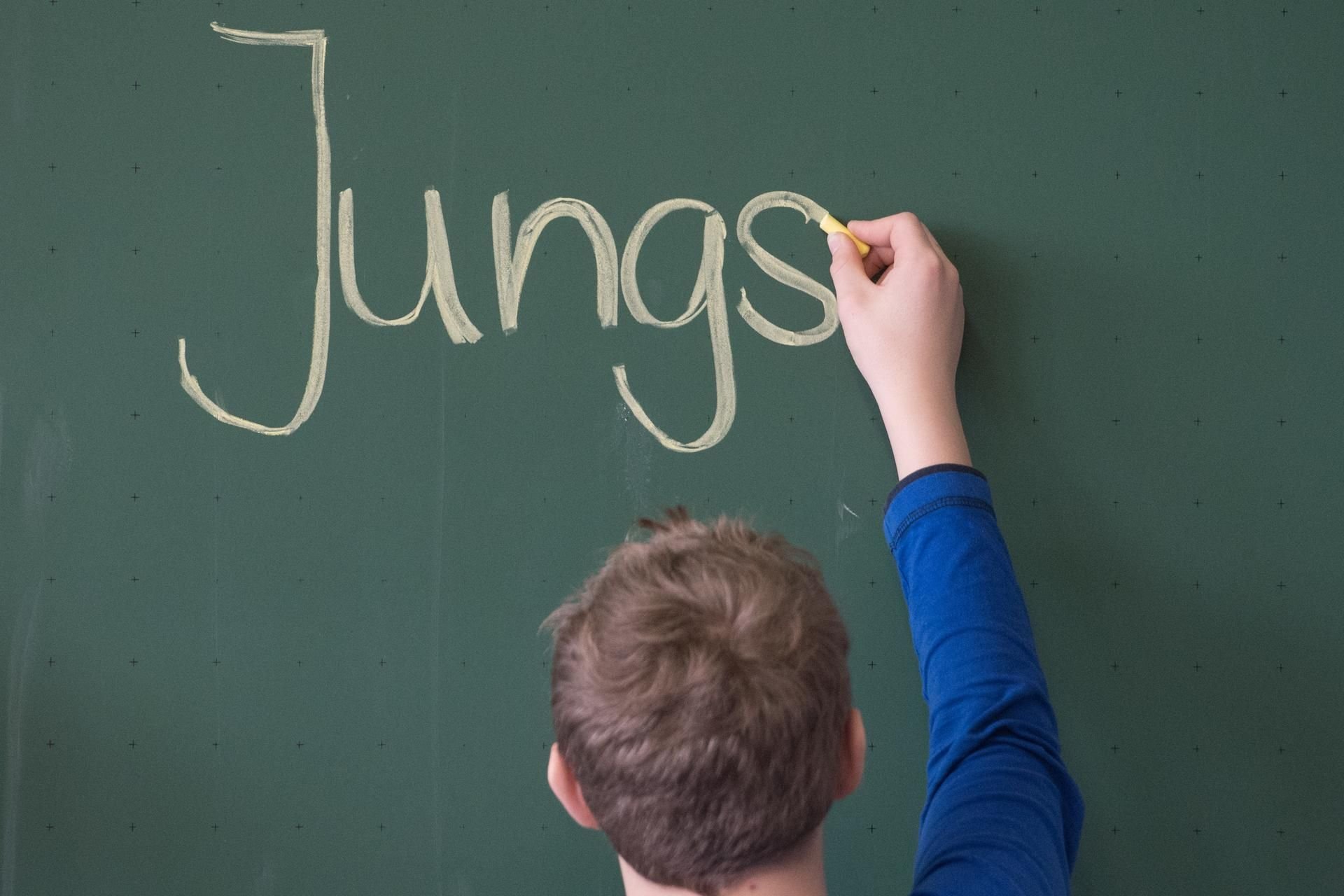
Tübingen - Abgelenkt und unkonzentriert: Jungs werden oft Probleme in der Schule nachgesagt. Woran das liegt und ob das wirklich so ist, erklärt Bildungsforscher Dr. Reinhard Winter im Interview.
Winter ist Experte für Jungenthemen und berät Eltern in Erziehungsfragen. Er ist in der Leitung des Sozialwissenschaftlichen Instituts Tübingen.
Herr Winter, Jungen gelten seit 20 Jahren als Bildungsverlierer. Sind sie das wirklich?
Reinhard Winter: Da ist etwas Wahres dran, aber gleichzeitig ist diese Zuschreibung auch ein ärgerliches Klischee. Die Medien haben die Jungen als Bildungsverlierer überdramatisiert. Und viele Eltern haben es daraufhin verinnerlicht: Na gut, mein Sohn ist eben ein Bildungsverlierer. Das kann zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Denn die Jungen hören und spüren das und das ist nicht förderlich für sie.
Was brauchen Jungen denn überhaupt, um gut durch die Schule zu kommen?
Winter: Da braucht es vieles. Es ist sicher vorteilhaft, wenn sie eine gewisse Wachheit mitbringen, also von sich aus ein Interesse am Lernen. Das ist aber etwas Biologisches, das haben so gut wie alle Kinder. Dann braucht es eine Schule, die dazu korrespondiert, die auch Themen bietet und aufgreift, die Jungen interessieren. Nicht immer und nicht ständig, aber doch hin und wieder. Und dann braucht es Eltern, die ihre Söhne angemessen begleiten. Das ist ein Zusammenspiel. Wenn eine dieser drei Säulen wegbricht, wird es schwierig.
Schulprobleme sind unter Eltern von Jungen ein großes Thema. Erleben Sie das auch?
Winter: Das ist wirklich eklatant. Ich merke das immer wieder in meiner Beratung und auch in meinen Vorträgen.
Wenn ich dort scherzhaft am Anfang frage, wessen Sohn denn keine Probleme in der Schule hat, meldet sich niemand, oder allenfalls ganz wenige.
Die meisten Eltern sind alltäglich vom Thema Schule betroffen. Und es wird für sie oft sogar zum Endlos-Thema. Ehrlich gesagt bin ich selbst ziemlich erschrocken, wie groß das Thema für die Eltern ist.
Kommt es daher, dass die Bedürfnisse von Jungen in der Schule nicht ausreichend berücksichtigt werden?
Winter: Nun, ich versuche mich zurückzuhalten, hier jemandem den Schwarzen Peter zuzuschieben. Viele Schulen sind wirklich sehr bemüht. Aber es gibt in unseren Schulen diese Grundtendenz, dass vor allem auf das kognitive, akademische Lernen Wert gelegt wird. Hier könnten sich die Schulen wirklich weiter entwickeln, vor allem in Bezug auf die Themen Beziehung, Handeln und Bewegung. Denn etwa bis zur 9. Klasse haben die Jungen einfach den Impuls, etwas Aktives zu machen und sich mehr zu bewegen. Aber das wird von den Schulen eher als lästig angesehen, es wird ausgelagert in die wenigen Stunden Sport pro Woche. Das ist aus meiner Sicht ein falsches Verständnis von Lernen.
Wie ginge es besser?
Winter: Warum nicht Bewegungseinheiten in den Unterricht integrieren? Viele Jungs haben das Gefühl, dass sie sich noch nicht einmal in der Pause richtig austoben können, denn auch dort wird vieles reglementiert und in Nischen gepresst. Was natürlich nicht heißt, dass Jungen nicht lernen müssten, sich selbst zu kontrollieren, denn das müssen sie. Aber es sollte kein völliges Ungleichgewicht entstehen. Was Lehrkräfte außerdem oft nicht so gut im Blick haben, ist die Beziehung zu den Jungen. Viele Jungen wollen sich reiben. Deshalb sind Konflikte für sie Beziehungsformen.
Und zudem gilt es unter Jugendlichen ja auch noch als cool, möglichst wenig für die Schule zu tun.
Winter: Genau. Bewundert wird höchstens der, der genial ist. Also der, der gute Noten hat, aber nichts dafür tun muss. Alle anderen riskieren, als Streber abgewertet zu werden. Das ist eine Unart. Dieses Thema müsste in den Schulen viel mehr aufgegriffen werden. Ich kenne aber bisher keine Schule, die aktiv etwas dagegen tut. Der Streber-Vorwurf mag nur ein Mosaik-Steinchen sein, doch er kann einen ambitionierten Jungen tatsächlich ausbremsen.
Was können Eltern tun, um ihrem Sohn zu helfen?
Winter: Viele sind sich nicht bewusst, dass sie Modelle sind für ihre Kinder. Auch wenn sie selbst keine Schüler mehr sind und keine Hausaufgaben mehr machen, ihre Haltung und ihre Einstellung ist prägend. Väter sind der Prototyp fürs Männliche. Es gibt tatsächlich viele, die vor ihren Söhnen erzählen: „Ich habe früher auch nie etwas für Deutsch gemacht und Mathe habe ich auch nie verstanden.“ Für die Leistungsbereitschaft des Jungen ist das nicht förderlich. Wir wissen, dass solch eine Einstellung sozial weiter vererbt wird. Wenn die Väter nicht reflektieren, kommen die Söhne nicht in die Leistung, die sie tatsächlich bringen könnten. Gleiches gilt für das Lesen: Viele Väter schieben das Vorlesen den Müttern zu, und sie zeigen sich in der Familie nicht als Lesende. Für Söhne ist es dann oft schwierig, den Zugang zum Lesen zu finden.
Was können Eltern sonst noch konkret tun?
Winter: Sie sind Informanten für ihre Kinder, sie haben einen großen Wissensvorsprung und sie können ihren Kindern ein Stück weit Handwerkszeug mitgeben. In meinem Buch nenne ich das zum Beispiel „Impression Management“. Hier geht es darum, wie Jungs vor ihren Lehrerinnen und Lehrern einen guten Eindruck machen. Mädchen haben das aufgrund ihrer Sozialisation meist schon gut drauf, sie spüren, was die Lehrerin gerade will und braucht und nicken zum Beispiel im Unterricht intuitiv. Solche Techniken können Eltern ihren Söhnen vermitteln. Zudem sehe ich Eltern in der Rolle eines Coaches. Sie können strukturieren, an die Zeiten für Hausaufgaben erinnern, die Impulskontrolle einüben und dem Sohn beibringen, dass er abends sein altes Schulbrot aus dem Ranzen holt. Irgendwann sollten sich Eltern aber auch raushalten.
Warum ist das so wichtig?
Winter: Kinder sind genervt, wenn sich Eltern ständig in ihre inneren Angelegenheiten einmischen. Das gilt für Mädchen genauso, aber Jungs provozieren das Einmischen wahrscheinlich mehr. Sie brauchen generell mehr Orientierung, Führung und Halt.
Warum fällt es den Eltern von Jungen denn oft so schwer, sich rauszuhalten?
Winter: Das hängt mit Vorstellungen zusammen, die wir über Geschlechter haben. Die Standardbiographie von Mädchen schließt das Muttersein mit ein, sie haben zwei Optionen für die Zukunft, die Berufs- und die Familienphase. Für die Jungen gibt es nur die eine Option: Beruf. Das wissen die Eltern und spüren die Söhne, deswegen ist der Druck stärker, der auf ihnen lastet. Doch das ständige Drängen geht oft nach hinten los.
Ein Unterkapitel Ihres Buches heißt „Weniger Mutter ist manchmal mehr“. Bemuttern wir Mütter immer noch zu viel?
Winter: Ja doch, vor allem die Mütter von Söhnen. Die Überfürsorglichkeit ist vor allem ein Mutter-Sohn-Thema, das ist auffällig. Es gibt Mütter, die ihrem Drittklässler noch den Ranzen in die Klasse tragen oder ihm die Hausschuhe anziehen. Sie merken nicht, dass sie ihrem Sohn damit mehr schaden als nutzen. Ihren Töchtern gegenüber sind Frauen in der Regel kritischer, sie verlangen ihnen von klein auf mehr ab. Das macht es den Mädchen dann aber auch leichter in der Schule.
Eltern sollten also Strukturen schaffen und dem Kind nicht die Aufgaben abnehmen.
Winter: Ja, sie sind für die Hintergrund-Arbeit zuständig. Sie sorgen für Struktur und Klarheit und vermitteln, dass Hausaufgaben auch dann zu erledigen sind, wenn man keine Lust dazu hat. Schulprobleme können sich sonst zu einem Teufelskreis aufschaukeln. Wenn der Junge immer weniger erzählt, verfallen die Eltern in Panik. Dann zieht sich das Kind noch mehr zurück, lässt sich noch weniger in die Karten schauen und die Eltern bekommen dann irgendwann nur noch das Zeugnis mit.
Und trotzdem finden Sie: „Für Jungen sind Super-Eltern ein Horror.“
Winter: Stimmt, das gilt übrigens für alle Kinder. Für Eltern geht es darum, einen Mittelweg zu finden. Ich glaube nicht, dass es in der heutigen Zeit möglich ist, alles richtig zu machen. Im Gegenteil, Perfektionismus ist der falsche Weg. Jungs müssen ab und zu über die Schule schimpfen dürfen und manchmal auch über ihre Eltern. Es gehört dazu, dass ihre Söhne sie auch mal blöd finden, stabile Eltern können das aushalten. Und Eltern sollten nicht immer nur harmonisch sein wollen, es braucht den Streit. Und dabei dürfen sie auch Fehler machen.
In Ihrem Buch schreiben Sie: „Schwierigkeiten treten auf, weil wir uns weiterentwickeln wollen.“
Winter: Ja, ich glaube, dass Probleme ein Hinweis für Entwicklungen sein können und dass wir uns auch als Eltern in schwierigen Situationen eher weiterentwickeln. Auch in meiner Beratung habe ich es oft erlebt, dass Eltern sagen: Ja, das war damals wirklich schwierig, das Mobbing, die Ticks, das Sitzenbleiben. Aber im Rückblick waren es wichtige Phasen. Das erkennt man natürlich nie in der Situation selbst. Es lohnt sich aber, das positiv anzuschauen. Nicht der Junge ist falsch, er ist nur ein Symptomträger. Denn auch die Eltern sind so gut wie immer in das Problem verstrickt. Und sich hier zusammen mit dem Sohn weiter entwickeln zu können, ist ein Geschenk.
In vielen Kindergärten und Grundschulen arbeiten fast nur Frauen. Wie wirkt sich das aus?
Winter: Das ist ein struktureller Faktor, den man beachten muss, um die Jungen und ihre Unlust auf Schule besser zu verstehen. Frauen sind nicht schädlich für Jungen, aber den Jungen wird auf diese Weise vermittelt: Kindergarten und Schule, das ist nichts, was für Männer wichtig ist. Daran wird sich nichts ändern, so lange sich nichts Wesentliches am Lohnniveau tut.
Sie finden: „Schule bildet das Männliche bei Jungen dadurch, dass sie es anderen überlässt – ein wenig verantwortliches Konzept.“
Winter: In der Schule werden Männlichkeitsexperimente abgewertet, nicht ohne Grund natürlich. Aber Jungen erhalten dort auch keine Anregung, nur im Negativen: So nicht! Und Jungen fällt es daher schwer, in der Schule ein neues, differenziertes Bild von Männlichkeit zu entwickeln. Es fehlen die Modelle, es gibt immer noch viel zu wenige männliche Lehrer. Auch thematisch fehlen Jungen anregende Stoffe, die Inhalte. Jungen bekommen keine Resonanz darauf, wenn sie Interesse an speziell männlichen Themen haben. Ich habe zum Beispiel einmal an einer Schulen mit Jungen an einer Erörterung zum Thema gearbeitet: Wie werde ich ein Mann? Die Lehrerin selbst hatte sich das Thema nicht zugetraut. Das Thema Männlichkeit treibt viele Jungen um, doch die Schule hat keine Antworten.
Und die Jungen müssen die Antworten dann woanders finden.
Winter: Ja, denn sie sehen ja in den Medien, an Umkleidekabinen, Toiletten und Spielsachen, dass das Geschlecht im Alltag doch eine sehr bedeutsame Rolle spielt. Sie finden die Antworten dann bei Gleichaltrigen oder in den Medien. Da muss man sich nicht wundern, dass eher traditionelle Geschlechterrollen zementiert werden.
Alles nicht so einfach für Jungen.
Winter: Das stimmt. Umso erstaunlicher ist, dass viele trotzdem so gut gedeihen. Das zeigt, dass die Resilienz dank ihrer Eltern bei vielen gut ausgeprägt ist. Wenn Eltern ihre Aufgaben einigermaßen gut hinkriegen und sich ihrer Bedeutung bewusst sind, dann schaffen es die Jungs meist auch durch die Schule.




