Versicherungsbedingungen Versicherungsbedingungen : Verstehen Sie Bahnhof?
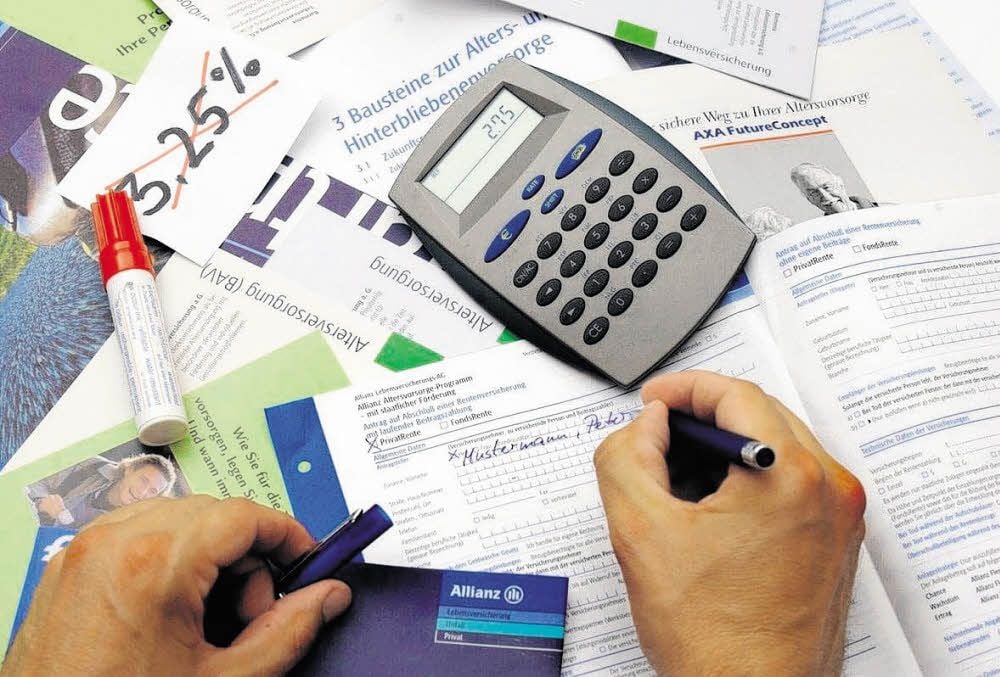
Hale (Saale) - Mit Versicherungsbedingungen können Laien oft wenig anfangen. Dabei entscheiden Fachbegriffe im Kleingedruckten darüber, ob der Versicherer einen Schaden bezahlt oder nicht. Das Vergleichsportal TopTarif hat exemplarisch einige Begriffe hinterleuchtet, die kaum ein Verbraucher kennt, obwohl sie schnell jeden betreffen können. Die MZ erklärt einige:
Regressansprüche
Regressansprüche sind ganz allgemein Rückforderungen von Versicherungen. Übernimmt zum Beispiel die Krankenkasse zunächst die Arztkosten eines Unfallopfers, kann sie die Kosten per Gesetz später vom Verursacher zurückfordern, den Verbraucher in Regress nehmen. Hier springt dann normalerweise die Haftpflicht-Versicherung des Unfallverursachers ein. Ausnahmen sind Familienmitglieder und Ehepartner. Hier darf die Krankenkasse keine Regressansprüche stellen. Knifflig wird es bei unverheirateten Paaren, die eine gemeinsame Haftpflicht haben. Denn die Haftpflicht zahlt bei Schäden untereinander nicht. Trotzdem würde die Krankenkasse die Kosten vom Verursacher zurückfordern.
Tipp: Unverheiratete Paare sollten alte Verträge prüfen und darauf achten, dass in der Familien-Haftpflicht Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern abgedeckt sind. Dann übernimmt der Versicherer die Regressforderungen der Krankenkasse.
Gliedertaxe:
So makaber das klingt, Gliedmaßen und Sinnesorgane werden von Unfallversicherungen mit einem Wert bemessen - der Gliedertaxe. Zum Einsatz kommt die Gliedertaxe, wenn nach einem Unfall ein dauerhafter Schaden festgestellt wird. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat Richtwerte ermittelt. Der Verlust eines Zeigefingers würde demnach mit einem Invaliditätsgrad von 10 Prozent bewertet. Bei einer Versicherungssumme von 200 000 Euro bekäme ein Versicherter also 20 000 Euro.
Tipp: Viele Versicherer erfüllen mehr als die vom GDV geforderten Werte. Deshalb lohnt sich ein Blick in die Gliedertaxe vor Abschluss des Vertrages. Denn wenn ein teurerer Tarif den Zeigefinger zum Beispiel mit 30 Prozent taxiert, bekommt das Unfallopfer schon 60 000 Euro statt 20 000 Euro.
Obliegenheitsverletzungen:
Auch ein Versicherungsnehmer hat Pflichten. Verletzt er diese, muss er aufgrund von Obliegenheitsverletzungen damit rechnen, dass die Versicherung einen Schaden nicht oder nicht komplett bezahlt. Wird zum Beispiel wegen Fassadenarbeiten ein Baugerüst aufgestellt, muss die Hausratversicherung informiert werden. Denn: Das Gerüst erhöht die Gefahr, dass Diebe einsteigen. Kommt es tatsächlich zu einem Einbruch, kann die Versicherung sich auf Obliegenheitsverletzung berufen und ihre Leistung kürzen.
Tipp: Verbraucher sollten ihre alten Verträge prüfen. Oft ändern sich mit der Zeit die Lebensbedingungen und damit auch die Konditionen von Versicherungen. So ändert sich zum Beispiel der Rabatt in der Kfz-Versicherung, wenn das Auto nicht mehr in der Garage steht.
Kleingebinde:
Als Kleingebinde bezeichnet man Flüssigkeiten in kleineren Mengen. Für die Haftpflicht sind umweltschädliche Flüssigkeiten und Stoffe interessant – wie Öl oder Benzin. Gelangen diese zum Beispiel in ein Gewässer, kann ein hoher Schaden entstehen. Dafür haftet der Verursacher und die Haftpflichtversicherung muss zahlen.
Tipp: Die Privathaftpflicht springt natürlich nicht für große Chemikalienlager ein. Deshalb ist die Menge solcher Kleingebinde, für die Schutz besteht, eingeschränkt – oft auf wenige 100 Liter. Wer viele Behälter im Keller stehen hat, sollte in seiner Police nachlesen.
Allmählichkeitsschäden:
Der Begriff Allmählichkeitsschäden findet sich zumeist bei Haftpflichtversicherungen und Gebäudeversicherungen und bezeichnet solche Schäden, deren Ursachen zu Beginn unerkannt beziehungsweise unbekannt sind und die häufig nur schleichend auftreten und zunächst unbemerkt bleiben. Ein Beispiel aus der Haftpflichtversicherung: Beim Blumengießen tritt regelmäßig und unbemerkt ein wenig Wasser über den Rand der Untertöpfe, wodurch der Parkettboden beschädigt wird. Beim Auszug verlangt der Vermieter Schadenersatz. Hier springt die Haftpflicht des Mieters ein. Oder: Durch Bauarbeiten auf einem Grundstück wird unbemerkt die Wasserleitung beschädigt. Erst Wochen oder gar Monate später wird der Schaden dadurch erkannt, dass sich Schimmel im Keller des Wohnhauses bildet.
Tipp: Vorsicht bei alten Haftpflicht-Policen: Sie schützen oft nicht bei Allmählichkeitsschäden und die Versicherten bleiben auf dem Schaden sitzen. Erst 2008 hat der GDV sie in seine unverbindlichen Musterbedingungen aufgenommen. Da hilft ein Wechsel auf aktuelle Konditionen.
Allgefahrendeckung:
Eine Allgefahrendeckung schützt, wie der Name schon sagt, gegen alle Gefahren – außer die, die ausgeschlossen sind. Die einfache Formel lautet: Gerät kaputt, der Schaden wird bezahlt. Die Allgefahrendeckung unterscheidet sich damit von der Hausratversicherung, die für konkret benannte Gefahren wie Feuer oder Einbruch zahlt. Ausgeschlossen sind in der Allgefahrendeckung auch die Schäden durch Abnutzung.
Ein Beispiel für die Allgefahrendeckung: Es gibt Handyversicherungen, die auch für das kaputte Display eines heruntergefallenen Smartphones bezahlen. Solche Beschädigungen an eigenen Sachen sind Beispiele für eine Allgefahrendeckung.
Tipp: Prüfen Sie, ob eine Allgefahrendeckung wirklich gebraucht wird. Der Versicherungsschutz ist zwar umfangreich, aber das macht die Verträge oft relativ teuer. Andererseits wird teilweise nur der Zeitwert ersetzt, nicht der Anschaffungswert.
Subsidiärdeckung:
Wenn ein Risiko oder ein möglicher Schadenfall durch zwei unterschiedliche Versicherungsverträge abgedeckt ist, spricht man von einer Subsidiärdeckung – oder auch von einer Subsidiärklausel.
Ein Beispiel: Beim Mietwagen im europäischen Ausland ist im Preis zumeist eine Kfz-Haftpflicht einbegriffen. Ist darüber hinaus die Mallorca-Police Bestandteil der eigenen Autoversicherung, kann man in diesem Fall von einer Subsidiärdeckung sprechen.
Tipp: Andere Versicherungsverträge, die gleiche Risiken abdecken, haben Vorrang. Nur dann, wenn aus anderweitigen Verträgen keine Leistung erbracht wird, setzt die vereinbarte Leistung aus dem Vertrag mit der vereinbarten Subsidiärdeckung ein.
Prolongationsklausel:
Hinter der Prolongationsklausel versteckt sich die automatische Verlängerung des Versicherungsvertrages. Beispiel: Hat der Kunde eine private Haftpflicht zum 1. Januar 2016 abgeschlossen, läuft diese bis zum 31. Dezember 2016. Wird der Vertrag nicht gekündigt, bleibt der Versicherungsschutz bestehen und verlängert sich in der Regel immer um jeweils ein weiteres Jahr.
Tipp: Die Prolongationsklausel findet sich in fast jedem Versicherungsvertrag. Für den Kunden hat sie den Vorteil, dass er für die Fortführung des Versicherungsschutzes nicht aktiv werden muss, hat er den Vertrag einmal abgeschlossen.
Wer einen Vertrag allerdings kündigen will, muss auf die Kündigungsfristen schauen.
Weitere Begriffserklärungen im Internet unter:www.news.toptarif.de und www.gdv.de


