Gartenarbeit für Anfänger Gartenarbeit für Anfänger: Verwirrende Gärtnersprache
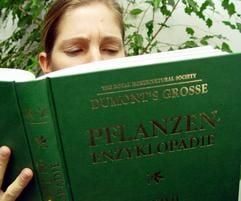
Bonn/dpa. - Schüler plagen sich mit Englisch oder Latein, Touristen in Paris mit der Speisekarte auf Französisch - und auch angehende Hobbygärtner dürften gelegentlich das Gefühl haben, sie müssten eine Fremdsprache lernen. Was meinen die Experten bloß, wenn sie vom Pikieren sprechen? Haben F1-Hybriden etwas mit der Formel 1 im Motorsport zu tun? Was bedeutet dreimal verpflanzt? Wie alle Fachsprachen ist auch die Sprache der Gärtner für Anfänger ein wenig verwirrend. Aber keine Angst: Das Wichtigste lernt sich rasch.
Die erste Hürde hat bereits genommen, wer weiß, dass die Gärtner nicht nur zwischen einjährigen, zweijährigen und mehrjährigen Pflanzen unterscheiden, sondern die mehrjährigen auch in Stauden und Gehölze untergliedern. Stauden werden alle Pflanzen genannt, die nicht verholzen und dennoch mehrjährig sind. Bei vielen von ihnen - Rittersporn oder Funkie zum Beispiel - sterben die oberirdischen Teile im Herbst ab. Sie ziehen ein, heißt das in der Fachsprache.
Das bedeutet jedoch nicht, wie mancher glaubt, dass die Pflanze tot ist: Unter der Erde warten die Knospen auf das nächste Frühjahr. Andere Stauden wie Christrose, Hirschzungenfarn oder Bärenfellgras besitzen so genannte ausdauernde Blätter. Sie bleiben auch während des Winters grün. Auch die Erdbeere ist eine Staude, die Rose dagegen nicht. Ihre Triebe verholzen, und daher gehört sie wie alle anderen Bäume und Sträucher zu den Gehölzen.
Viele gärtnerische Fachbegriffe ranken sich um das Vermehren von Pflanzen. Wer Samentütchen in der Hand hält, stößt auf die Ausdrücke Frost-, Dunkel- oder Lichtkeimer. Damit sind die Bedingungen gemeint, unter denen der Samen keimt. Frostkeimer regen sich erst, wenn sie eine Kälteperiode erlebt haben. Dunkelkeimer wollen im Schutz der Erde keimen, und Lichtkeimer besiedeln in der Natur unbewachsene Böden, wie sie bei Windbruch oder Hangrutschungen entstehen. Erst helles Licht signalisiert ihnen günstige Bedingungen.
Feine Samen werden oft umhüllt, damit sie sich leichter aussäen lassen. Gärtner sprechen dann von pilliertem, also pillenförmigem Saatgut oder von gecoatetem, also ummanteltem Samen. Stratifiziertes Saatgut wurde in groben, feuchten Sand geschichtet, der die harte Samenschale ankratzt und so das Keimen erleichtert.
Auch «F1-Hybriden» steht auf vielen Samentütchen. Das hat freilich nichts mit Autorennen, sondern mit Züchtung zu tun. Die F1-Hybriden entstehen als Kreuzung zweier verschiedener Elternstämme, die in der Gärtnerei auf Vererbung bestimmter Eigenschaften hin ausgelesen wurden, etwa auf eine bestimmte Farbe oder auf schnelle Entwicklung der Wurzeln. Bei richtiger Kombination vereinen die Nachkommen die besten Eigenschaften der Eltern - gehören also quasi zur Formel 1 der Samen. Doch schon die nächste, die F2-Generation, zeigt neben erwünschten auch wieder weniger erwünschte Eigenschaften. So genannte reinerbige Sorten bleiben dagegen über Generationen hinweg gleich.
Egal ob Sorte oder F1-Hybride: Sind die Samen gekeimt und herangewachsen, wird pikiert. Dazu nimmt sie der Gärtner aus der Saatkiste, kürzt ihre Wurzeln und pflanzt sie neu. Das zwingt die Pflanzen, die Wurzeln stärker zu verzweigen. Auf diese Weise wachsen sie kräftiger. Ähnlich verfahren Baumschulen: Sie zwingen Bäume und Sträucher durch regelmäßiges Verpflanzen dazu, viele Feinwurzeln zu bilden. Die Häufigkeit des Verpflanzens ist daher ein Maßstab für Qualität und Größe. Besonders wertvolle Gehölze können sieben Mal und mehr verpflanzt worden sein.
Derartige Prachtexemplare werden als Solitäre bezeichnet. Sie stehen am besten etwas entfernt von anderen Pflanzen, damit ihre Schönheit sich voll entfalten kann. Solitäre nennen die Gärtner aber auch Großstauden wie Pampasgras oder Mammutblatt, die einzeln am besten zur Wirkung kommen, und Solitäre sind auch große Exemplare von Topf- und Kübelpflanzen wie Palmen oder große Engelstrompeten, die die Blicke auf sich ziehen.
Kompliziert wird es mitunter, wenn es um die Namen von Pflanzen geht. So mag ein Garten-Neuling von Maßliebchen, Tausendschönchen oder Marbelblümchen hören - ohne zu wissen, dass sich dahinter jeweils nicht anderes als das Gänseblümchen verbirgt. Um Ordnung zu schaffen, entwickelte Carl von Linné 1735 ein bis heute international gültiges System. Darin trägt jede Pflanze einen Gattungs- und einen Artnamen.
Alle Gänseblümchen-Schwestern zum Beispiel haben den Gattungsnamen Bellis, abgeleitet vom lateinischen bellus, zu deutsch: schön. Unser wildes Gänseblümchen ist mehrjährig, was sich im Artnamen perennis widerspiegelt. Aus der Wildblume züchten die Gärtner immer wieder neue, verschiedenfarbige Sorten. Sie bekommen vom Züchter einen Sortennamen und heißen dann etwa Bellis perennis 'Pomponette'.




