Besser abschaffen? Besser abschaffen?: "Hausaufgaben schaffen soziale Ungerechtigkeit"
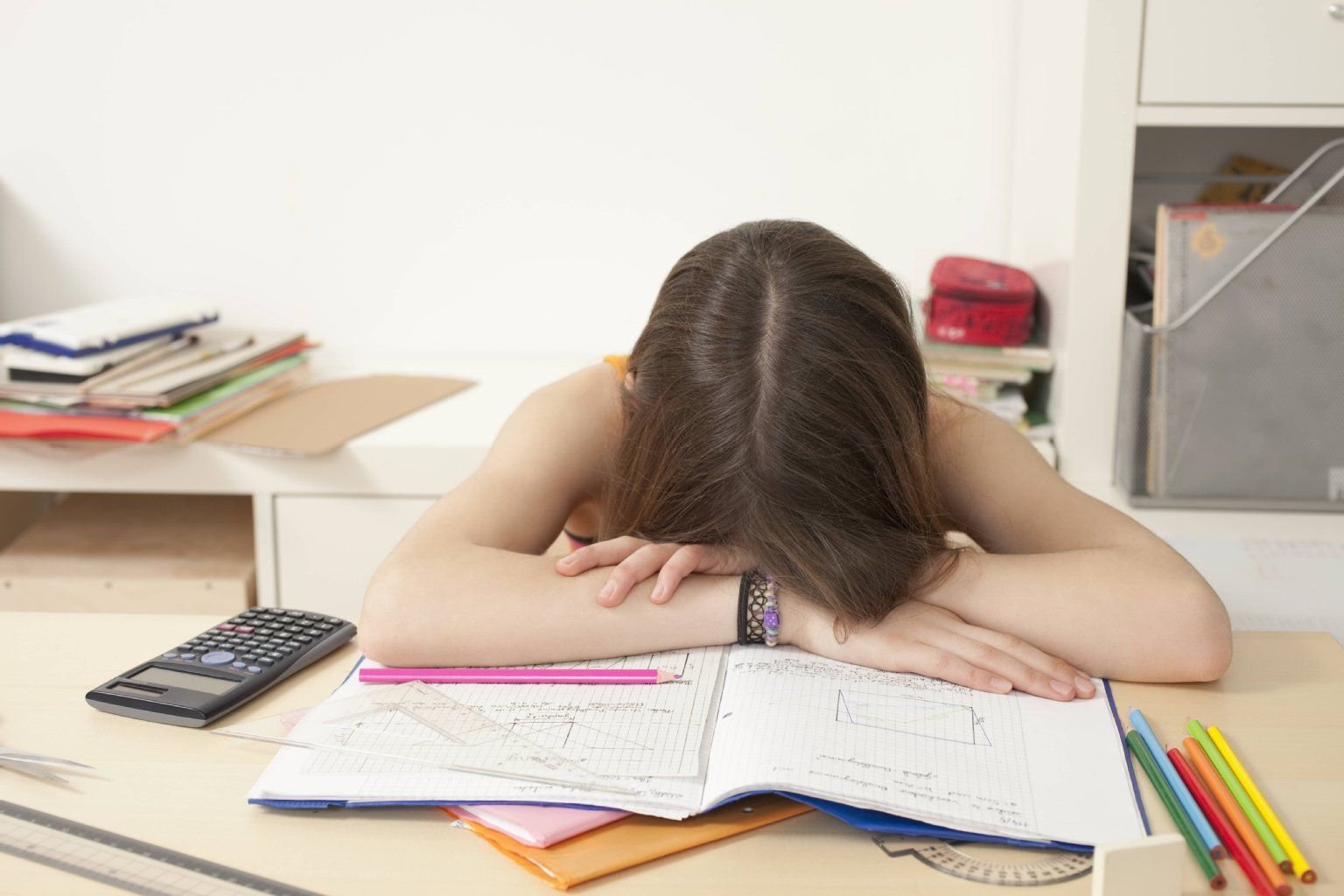
Nach Schulschluss gibt es Mittagessen, vielleicht eine kleine Pause und dann setzen sich die Kinder an die Hausaufgaben. Wer Schulkinder hat, kennt diesen Tagesablauf und nimmt die Aufgaben am Nachmittag hin – auch wenn die Kinder murren. Da müssen sie halt durch. War ja schließlich immer so. Oder?
Schon seit dem 15. Jahrhundert gibt es Hausaufgaben, erst in den 1880er Jahren wurde zum ersten Mal nach Sinn und Unsinn der Aufgaben gefragt. Es gab heftige Diskussionen, ob die Aufgaben pädagogisch sinnvoll und gesundheitlich zumutbar seien. In den 60er Jahren äußerte ein Erziehungswissenschaftler zum ersten Mal die Frage, ob Hausaufgaben Hausfriedensbruch seien.
Studien konnten bislang keinen Aufschluss über die Sinnhaftigkeit von Hausaufgaben geben. Im schweizerischen Kanton Schwyz wurden 1993 die Hausaufgaben abgeschafft. Die Wochenstundenzahl der Schüler wurde um eine Stunde erhöht. Zwar wurden nach vier Jahren die Hausaufgaben auf Druck der Öffentlichkeit wieder eingeführt, jedoch zeigten die Untersuchungen, dass die Schüler mit Hausaufgaben (im Kanton Zug) und die Schüler ohne Hausaufgaben (Kanton Schwyz) auf demselben Entwicklungsstand waren.
Der einzige Unterschied bei den untersuchten Gruppen: Die Kinder ohne Hausaufgaben fühlten sich geringer belastet und höher motiviert.
„Hausaufgaben werden überschätzt“
Bildungsjournalist Armin Himmelrath hat dem Thema ein ganzes Buch gewidmet: „Hausaufgaben – Nein Danke!“. Er sagt, Hausaufgaben seien „sozial ungerecht, pädagogisch fragwürdig und persönlich belastend“. Als Vater dreier Kinder findet er zudem, die Wirkung der Hausaufgaben für den Lernprozess werde völlig überschätzt.
Konkret meint Himmelrath die ungleichen Chancen. Weil nicht alle Elternhäuser die gleiche Unterstützung bei den Hausaufgaben anbieten könnten, schaffen sie soziale Ungerechtigkeiten. „Wer als Schülerin oder Schüler Probleme und nicht die richtige Hilfe im Hintergrund hat, verliert durch die Hausaufgaben – und nicht etwa trotz der Aufgaben – schnell den Anschluss an die Unterrichtsinhalte. Das zeigen Forschungen etwa des Wissenschaftszentrums Berlin“, sagt er und schlägt darum vor, statt Hausaufgaben lieber „Schulaufgaben“ zu entwickeln und einzusetzen.
Über den Sinn und Unsinn von Hausaufgaben hat sich Himmelrath viele Gedanken gemacht. Das sind die wichtigsten Fragen.
Sind Hausaufgaben Hausfriedensbruch?
In einem Gespräch mit dem Fachanwalt für Arbeits- und Verwaltungsrecht, Prof. Dr. Birnbaum klärt Armin Himmelrath die Frage nach dem Tatbestand des Hausfriedensbruchs. Der Anwalt zitiert Paragraf 123 StGB (verkürzt): Wer in die Wohnung eines anderen widerrechtlich eindringt oder ohne Befugnis darin verweilt, wird bestraft. Dieser Tatbestand ist bei Hausaufgaben nicht erfüllt.
Es gibt aber einen anderen Paragrafen, der in Frage käme, den zur Nötigung, §240 Strafgesetzbuch: Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafen bestraft. Birnbaum: „Also wenn man will, kann man bei nüchterner Betrachtung Hausaufgaben im Einzelfall darunter fassen.“ Die Aufgaben müssten dafür allerdings mit einer rechtswidrigen Drohung einhergehen, wie: „Du machst die Hausaufgaben, sonst kriegst du eine schlechte Note!“ Hausaufgaben können also zur Nötigung werden, sind aber rechtlich kein Hausfriedensbruch.
Was bedeuten Hausaufgaben für die Lehrer?
Für Lehrer bedeuten Hausaufgaben laut Himmelrath vor allem Zeitaufwand, denn für die Aufgabenstellung und die Kontrolle geht Zeit verloren. Ein weiteres Problem: Viele Schüler machen die Hausaufgaben bewusst nicht, vergessen sie oder lassen sich von ihren Eltern helfen. Himmelrath schreibt außerdem, dass besonders die Schüler bei den Hausaufgaben gewissenhaft arbeiteten, die die zusätzliche Übung gar nicht nötig hätten, während diejenigen mit Defiziten die Aufgaben eher sein ließen. Für die Lehrer heißt das, dass die guten Schüler besser werdeb, die schwächeren Schüler aber schwach bleiben und dadurch der Unterricht komplizierter wird.
Was bedeuten Hausaufgaben für die Schüler?
Für Schüler bedeuten laut Himmelrath Hausaufgaben vor allem Stress und eine Einschränkung ihrer Freizeit. Viele nehmen sie als lästiges Übel wahr. Die Aufgaben könnten zudem innerhalb der Familie Konfliktpotential schaffen, wenn sich Schüler von den Eltern unter Druck gesetzt oder falsch beraten fühlten.
Hilmar Schwemmer, selbst Lehrer, veröffentlichte 1980 eine Studie, für die er 450 Schülerinnen und Schüler über ihre Hausaufgaben berichten ließ. Die Ergebnisse machten deutlich, welch großer „Konfliktherd“ die Hausaufgabensituation in den Familien darstellt. Sein Fazit: Hausaufgaben beeinträchtigen die Chancengleichheit wegen der ungleichen Unterstützung in Elternhäusern.
Was bedeuten Hausaufgaben für die Eltern?
Für Eltern können laut Himmelrath die Hausaufgaben der Kinder zur Belastung werden, weil zu oft Druck oder Streit entsteht. Zudem sähen sich etliche Eltern gezwungen, Disziplinierungsmaßnahmen einzuführen, damit ihre Kinder die Aufgaben erledigen.
Jürg Brühlmann vom Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer sagt: „Viele Kinder können die Aufgaben zu Hause kaum erledigen, weil sie kein eigenes Zimmer haben, der Fernseher immer läuft oder die Geschwister stören.“ Außerdem hätten viele Eltern ab der fünften Klasse Mühe, die Hausaufgaben der Kinder selbst zu verstehen – besonders in fremdsprachigen Familien. Dadurch würde die Chancenungleichheit erhöht.
Welche Alternativen zu Hausaufgaben gibt es?
Hausaufgaben würden in unserem Bildungssystem als Disziplinierungs- und Selektionsinstrument erlebt, das die Schüler ganz auf sich zurückwerfe, schreibt Himmelrath. Er fordert eine Schule ohne Hausaufgaben. Es geht ihm darum, die Hausaufgaben zu Schulaufgaben umzuwandeln, die in der Gruppe und unter Aufsicht erledigt werden. Dabei plädiert er nicht für die Abschaffung von eigenständigen Lern- und Übungsleistungen der Schüler – sondern für das Zurückholen des Lernens in den Verantwortungsbereich der Schule.





