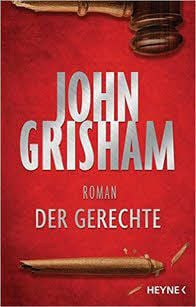John Grisham So wütet John Grisham über die US-Justiz

Halle - Er ist ein Mann auf einem Kreuzzug, das Schreibmaschinengewehr angelegt auf den Feind, der ihm in vielerlei Gestalt begegnet. John Ray Grisham Jr., 61 Jahre alt und ein Thriller-Weltstar, seit ihm Anfang der 90er Jahre mit „Die Jury“, „Die Firma“ und „Die Akte“ ein globaler Bestseller-Hattrick gelang, lässt nicht locker in seinem literarischen Kampf gegen die allgegenwärtige Ungerechtigkeit. In „Der Gerechte“, dem 24. Justizthriller seiner Karriere, nimmt der ehemalige Anwalt erneut das amerikanische Rechtssystem ins Visier.
Diesmal heißt Grishams Held Sebastian Rudd und er ist - wie so oft schon - ein desillusionierter Kleinstadtanwalt. Rudd hat den Glauben an die Gerechtigkeit verloren. Er verteidigt seine Mandanten nach dem Motto, dass am Ende immer der Recht bekommt, der am skrupellosesten dafür eintritt. Seine ethischen Grenzen zieht Rudd selbst. Er ist nicht bestechlich, weiß aber zu wirtschaften, er verbündet sich mit allen, die ihm nützlich sein können. Und trickst in Prozessen genauso kaltblütig wie die Freestyle-Fighter in den gewalttätigen Käfigkämpfen, bei denen er seine Freizeit verbringt.
Fast scheint es zu Beginn, als Rudd gerade wieder einen hoffnungslos vorverurteilten Mandanten gegen die Übermacht von Polizei, Staatsanwaltschaft und voreingenommener Jury verteidigt, dass der Großmeister aus den USA bei seinem deutschen Kollegen Ferdinand von Schirach („Verbrechen: Stories“) genau hingeschaut hat. „Der Gerechte“ entwirft nicht wie sonst üblich die Geschichte eines großen Falls, sondern er folgt den Spuren vieler kleiner.
Groß im Mittelpunkt dabei immer Sebastian Rudd, geschieden, Vater eines Sohnes, um den er mit seiner Ex beständig streiten muss, und stolzer Teilbesitzer eines hoffnungsvollen Käfigkämpfers. Wie der im Ring, so agiert der aus Sicherheitsgründen stets von einem schlagkräftigen ehemaligen Mandanten namens Partner begleitete Anwalt im Gerichtssaal.
Rudd fragt seine Klienten nicht, ob sie unschuldig sind, denn das spielt für ihn keine Rolle. Er sieht sich als Verteidiger, vor allem als Verteidiger des Rechts jedes Menschen, als unschuldig zu gelten, so lange seine Schuld nicht eindeutig er- und bewiesen ist.
Ein Position, die Sebastian Rudd zu einem Außenseiter im US-Justizsystem macht. Ringsum arrangieren sich Kollegen, Richter und Polizei. Grishams Held aber verstrickt sich mit Fortdauer der Handlung - die der Autor nun aus all den kleinen, zuvor nur angerissenen Geschichtchen häkelt - immer mehr im offenen Widerspruch zum Rechtssystem. Als sein Kickboxer am Ende eines Kampfes ausrastet und den Schiedsrichter erschlägt, findet eins zum anderen, und Grisham kann nun virtuos etwas Großes aus seinen vielen Handlungssträngen stricken.
Hier ist der Altmafiosi, der nach einem erfolgreichen Ausbruch aus der Todeszelle das gezahlte Verteidigerhonorar zurückhaben will. Dort der Polizeichef, der Rudds Sohn entführen lässt, um den Anwalt zu zwingen, seine Schweigepflicht zu brechen und Angaben zum Verschwinden der Polizeicheftochter zu machen. Und da sind die Freunde des inhaftierten Kickboxtalents, die den Schutz des Anwalts so ernst nehmen, dass sie ein paar Leute um- und ihn damit in eine unmögliche Position bringen.
Es ist allerdings keine, in der hier nicht alle Beteiligten die ganze Zeit über sind. Wie damals, Mitte der 80er, als Grisham vor Gericht die Zeugenaussage eines minderjährigen Vergewaltigungsopfers hörte, die ihn dazu inspirierte, einen Roman darüber zu schreiben, was passiert wäre, wenn der Vater des Mädchens die Täter erschossen hätte, spielt der Mann aus Mississippi auch hier wieder mit dem alten Was-wäre-wenn: Kann ein Rechtsbruch Gerechtigkeit schaffen? Wenn es das Justizsystem schon nicht schafft?
Es explodieren Autobomben, es wird entführt, gerächt, gesoffen. Für einen Justizthriller wird im neuen Grisham wenig plädiert und verhandelt, mehr taktiert, gedroht und hinter den Kulissen geschoben. Denn das, so die Botschaft von Grishams Gerechtem, ist vielleicht die einzige Art, wie sich das Recht noch schützen lässt - durch miese Absprachen, billige Tauschgeschäfte und Verrat. Am Ende kommt dann doch noch das Urteil heraus, das der normale Mensch als gerecht empfindet. Und sei es nur, weil die Justiz wie üblich versagt. (mz)