Museum am Theaterplatz Museum am Theaterplatz: Aufruhr in Chemnitz
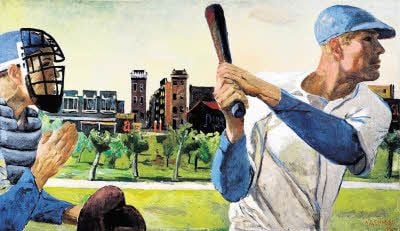
Chemnitz - Das Banner am Chemnitzer Theaterplatz wird den Uneingeweihten vielleicht erschrecken: „Revolutionär!“ steht darauf in riesigen Lettern. Dergleichen hat man seit dem Mauerfall, als die sinnfreien Parolen der DDR-Propaganda verschwanden, nicht mehr so häufig zu sehen bekommen. Aber keine Angst, es geht hier nicht um Klassenkampf, sondern um Kunst. Wieder einmal, wie schon so oft in den vergangenen Jahren, überrascht das Bildermuseum der sächsischen Stadt mit einer hochkarätigen Schau.
Nicht Pablo Picasso, nicht Bob Dylan ist es diesmal - vor dem Hintergrund des 100. Jahrestages der sozialistischen Oktoberrevolution werden 400 Werke von 110 Künstlern der russischen Avantgarde gezeigt. Und welch ein Reichtum an Fantasie, Leidenschaft und Experimentierlust offenbart sich beim Gang durch die Säle und Kabinette!
Wer in früheren Jahren in sowjetische Kunsthallen geführt worden ist, wird manchmal geseufzt haben - wenn es nicht gerade die Eremitage in Leningrad oder das Moskauer Puschkin-Museum gewesen ist. Denn abseits dieser Tempel des Schönen dominierten quadratmeterweise der Sozialistische Realismus und Naiv-Folkloristisches in den buntesten Farben.
Dass aber noch im zaristischen Russland, erst recht dann in den Jahren des Umbruchs nach 1917 Künstlerinnen und Künstler mindestens auf Augenhöhe (und auch im Austausch) mit ihren französischen und deutschen Kollegen eine ganz neue, eben revolutionäre Kunst wagten, ist vielen Europäern gar nicht erst zur Kenntnis gelangt.
Natürlich sind Namen wie Kandinsky, Lissitzky und Malewitsch geläufig, aber sie werden entweder nur aus ihrem Wirken im Westen, zumal in Deutschland - oder aber als singuläre Figuren verstanden. Beides aber ist falsch oder jedenfalls nicht richtig, das kann man nun in Chemnitz buchstäblich abholen und in einem dicken, vorzüglich gestalteten Katalog auch mit nach Hause nehmen.
Es wird hier, anhand der Leihgaben aus der Sammlung Vladimir Tsarenkov, eine solche Fülle künstlerischer Handschriften eröffnet, dass man nur staunen und immer noch neugieriger werden kann - Kuriosa durchaus eingeschlossen.
Hinreißend ist der von Wladimir Gelfrejch in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre geschaffene Entwurf für ein Lenin-Denkmal: Auf dem aufragenden Turm eines konstruktivistisch geschachtelten Quadergebirges steht ein winziger, silberfarbener Revolutionsheld und weist mit dem Arm in die Zukunft.
Die sah für die Künstler, die voller Begeisterung für das junge Sowjetsystem gearbeitet hatten, spätestens Ende der 1920er Jahre nicht mehr rosig aus, der Stalinismus mit seinem brutalen Herrschaftsanspruch und die Freiheit der Avantgarde vertrugen sich nicht.
Viele Künstler emigrierten in den Westen, andere passten sich an. Gelfrejch hat es mit Zuckerbäcker-Bauten des stalinistischen Klassizismus noch zu großem Ansehen als Architekt gebracht. Andere, wie die großartige Malerin Natalja Gontscharowa und ihr Partner Michail Larionow zogen es vor, nach Paris zu übersiedeln.
Allein der Bilder der Gontscharowa wegen lohnte die Fahrt nach Chemnitz. Unangepasst experimentierte sie mit Farbe und Stil, ihr Selbstporträt von 1907 zeigt eine selbstbewusste, aber auch skeptisch-zweifelnde Frau. Viel schöner hat Larionow, mit dem sie lebenslang zusammenblieb, auch wenn sie längst kein Liebespaar mehr waren, die Künstlerin im gleichen Jahr gesehen.
Beide Bilder hängen einander gegenüber, es ist eine Freude sie zu vergleichen.
Einen Teil der Schau nehmen Porzellane ein, hier freilich erweist sich der Anspruch als deutlich geringer, zudem gibt es schauerliche Zeugnisse sozialistischen Kitschs darunter. Aber auch dieser mag seine Liebhaber finden. (mz)
Museum am Theaterplatz Chemnitz, bis zum 12. März, Di-So 11-18 Uhr, Eintritt 8, erm. 6 Euro, Katalog 30 Euro




