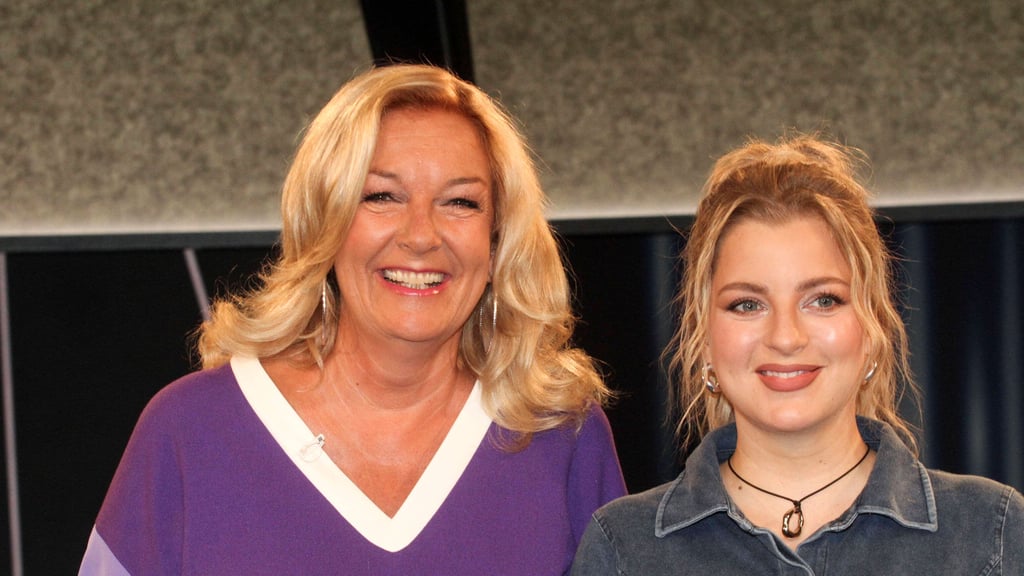Moritzburg Moritzburg: Immer an der Wand lang
HALLE/MZ. - Eine Brandwand soll das Übergreifen des Feuers von einem Gebäudeteil auf einen anderen verhindern. In der Regel wird die Wand rund 30 Zentimeter über das Dach hinaus geführt, um einen Feuerüberschlag auf der Dachhaut zu verhindern. Alternativ dazu ist eine beidseitige "Auskragung" des Mauerabschlusses bis dicht unter die Dachdeckung möglich. Die Brandwand der Moritzburg, die den West- vom Nordflügel des neu in die historischen Gemäuer installierten Museums zu trennen hat, ist weder das eine noch das andere.
Was da konkret als Brandwand errichtet wurde, war der Stadt Halle als Bauaufsichtsbehörde noch ein halbes Jahr nach der Eröffnung des Museums ein Rätsel. Man hatte im November 2005 die Genehmigung für den Neubau erteilt unter der Auflage, dass die Ausführungsplanung der Brandwand vor Baubeginn vorzulegen sei. Das erfolgte nicht bis über die Eröffnung des Museums im Dezember 2008 hinaus, die man als Stadt nicht gefährden wollte; Kompromiss-Varianten in Sachen Brandschutz machten es möglich. Im Juni 2009 schließlich, sagt der Leiter des Bauordnungsamtes, Günter Hannuschka, habe man eine hallesche Architektin in das Museum geschickt, um in Augenschein nehmen zu lassen, was da eigentlich Sache ist. Der Befund: Die Mauer endete rund 50 Zentimeter unter der Aluminiumdachhaut - und zeigte "Löcher", also nicht vorschriftsmäßig abgeschottete Lüftungskanäle.
Seitdem steht die Moritzburg im Mittelpunkt einer Diskussion, die längst die Qualität der Stiftungsführung in Frage stellt. Dabei ist die mangelhafte Brandmauer ein Symbol für die gravierenden bau- und verwaltungstechnischen Mängel im Ganzen. Um allen begrifflichen Haarspaltereien zuvorzukommen, muss man ja feststellen, dass eine unfertige Brandmauer so viel wert ist wie gar keine. Dieser Wand-Torso wird nun "ertüchtigt": nach knapp zwei Jahren laufendem Publikums- und Kunstbetrieb!
Nicht die erste, nicht die letzte Beseitigung eines Mangels: Im Frühjahr 2009 wurden die Fluchttreppe im Westflügel und der vom Nordbau aus zum Studentenclub "Turm" führende Notausgang gesetzt. Man hatte das vergessen. Insgesamt 63 Mängel listet die hallesche Bauaufsicht auf. Das könnte man durchwinken, wenn es sich nicht um ein überregional sichtbares Kunstmuseum mit erstklassigen Beständen handeln würde.
"Selbstverständlich", sagt Günter Hannuschka, "hätte ich die Baustelle 2008 stilllegen können. Aber dann wäre der Bau tot gewesen - und die Stiftung auch." Man sei also mit der Verfügung in Sachen Brandwand in eine Art Vertrauensvorleistung für das Projekt Moritzburg gegangen. Keine Ausnahme. "Die Entscheidung, unter Auflagen einen Bau nicht stillzulegen, treffen wir sehr oft", sagt der hallesche Bürgermeister Thomas Pohlack, Beigeordneter für Planen und Bauen. Man habe sich mit der Stiftung auf einen zeitlich befristeten Kompromiss geeinigt unter den Maßgaben: "Erstens, die Menschen müssen im Brandfall unbeschadet das Museum verlassen können. Zweitens, die Anlage muss nachgebessert werden." Bislang, sagt Hannuschka, hätten Land, Stadt und Stiftung so ein "Risiko" in Kauf genommen. Damit soll Schluss sein.
Über schmale Metallstiegen gelangt man in das zweite Geschoss des für den Ausstellungsbetrieb stillgelegten Nordflügels, dorthin, wo die Brandwand "ertüchtigt" wird. Was in diesem Fall heißt: Das Mauerwerk wird weder verlängert noch ausgekragt, sondern "abgekoffert". "Wir schaffen einen brandfreien Raum beidseitig der Wand", sagt der Bau-Referatsleiter der Stiftung Dome und Schlösser, Olaf Martin-Knauf. Im Klartext: einen mannshoch abgeschotteten Raum um den Abschluss der Brandwand herum, umschlossen von Trockenbauwänden und einem Trapezblechdach in Höhe des Mauerendes. Wände, die 90 Minuten einem Feuer standhalten sollen. "Die Lüftungskanäle entsprachen nicht der Standardlösung", sagt Martin-Knauf. "Das ist ein Mangel, der behoben wird." Beim Rundgang zeigt sich, dass im so genannten Erschließungsturm - einem Fluchttreppenhaus für den Ernstfall - die nur am Boden befestigten Absperrbrüstungen zum Schacht hin so beweglich sind, dass man hier keinen Personenandrang erleben will.
Im grünen Bereich bewegt sich die Behandlung des historischen Mauerwerkes: Durch einen "Opferputz" wird die Nässe aus den Außenmauern gezogen, einem vorläufigen Putz also, auf dem sich die ausgefällten Salze als weiße Flecken abzeichnen; das kann etwa 20 Jahre laufen. Unvollendet sind die Altfassaden zum Hof hin: Die müssen saniert und gesichert werden, irgendwann. Immerhin weiß man dort, was los ist - im Gegensatz zum Zustand der Gewölbe unter dem Westflügel. Diese wurden samt Crodel-Halle nach Auskunft der Bauaufsicht letztmals 2007 betreten. Günter Hannuschka: "Da ist alles zugemacht, da geht keiner rein." Und wenn, dann nur im Vollschutzanzug. Warum? Wie aus Kreisen der Landesdenkmalpflege zu erfahren war, soll bei der "Vernadelung" genannten Festigung der Westflügelmauern Wasser in die Gewölbe eingedrungen sein. Die Rede ist von starken "Feuchteschäden" und "biogenem Befall", also Schimmel. Ob das Gewölbe der Crodel-Halle beschädigt wurde, kann niemand sagen.
Die Stiftungsdirektorin Katja Schneider spricht davon, dass die Untergeschosse "ein bisschen in Mitleidenschaft" gezogen seien. Olaf Martin-Knauf teilt mit, dass ein "baubiologisches Gutachten" für die abgeschotteten Untertageräume in Auftrag gegeben sei. Woher die Nässe und der Schimmel stammen, ist für Martin-Knauf unklar. "Irreparable Schäden befürchte ich nicht." Aber nichts Genaues weiß man nicht: Nach drei Jahren!
Wie konnte es zu alledem kommen? Katja Schneider spricht von "Kommunikationsproblemen" zwischen allen am Bau beteiligten Parteien, die die Stiftung als Bauherrin zu führen hatte. Thomas Pohlack vermisst bei den spanischen Architekten die "Kompetenz für eine Arbeit im historischen Bau". Günter Hannuschka meint, man hätte statt einen privaten Projektsteuerer anzumieten, den Landesbaubetrieb wirken lassen müssen.
Ist die Überforderung durch den Bau Ursache für die gescheiterte Haushaltsführung der Stiftung? Das will der Präsident des Landesrechnungshofes Ralf Seibicke nicht gelten lassen; es gäbe Stiftungen, die große Baumaßnahmen korrekt durchzuführen wissen. Auch wenn der Vorstand der Moritzburg-Stiftung zuletzt 2006 - und nicht wie zuvor falsch berichtet 2004 - entlastet worden ist: "Die Vielzahl und die Schwere der Mängel sind besonders kritikwürdig". Ende November soll der Prüfbericht des Rechnungshofes vorliegen. Wie das Arbeitsgericht Halle am Montag auf MZ-Nachfrage mitteilte, wird es am 27. Januar in Sachen strittiger Kündigung zu einer Kammerverhandlung kommen, die der entlassene Verwaltungsleiter der Moritzburg gegen die Stiftung führt. Der Kläger wollte sich zum Verfahren nicht äußern.