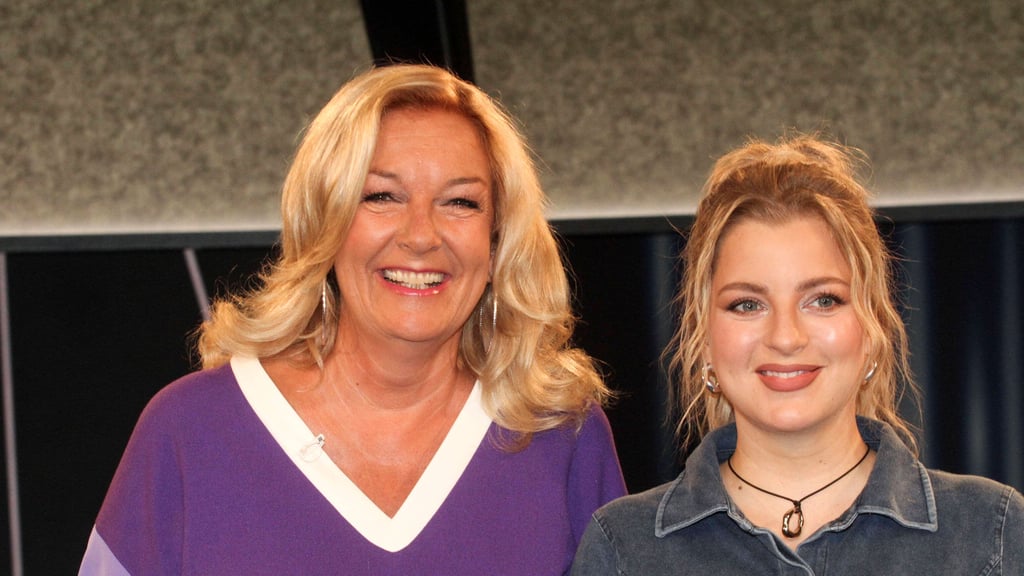Königstraum und Massenware: 300 Jahre Porzellan
Selb/dpa. - Eine so hochkarätige und facettenreiche Schau zum Thema Porzellan wird es wohl nie mehr geben: Mit der Ausstellung «Königstraum und Massenware» feiert das Porzellanikon im fränkischen Selb (Bayern) vom 24. April bis 2. November die 300-jährige Erfolgsgeschichte des Porzellans in Europa.
Mehr als 1000 Exponate von rund 100 Leihgebern aus 17 Nationen haben Museumsleiter Wilhelm Siemen und namhafte Kuratoren für die Jubiläumsschau zusammengestellt.
Der Titel «Königstraum und Massenware» dokumentiert die Geschichte einer Branche, deren Produkte sich Könige und Bürger gleichermaßen erträumten, betont Siemen. «Porzellan ist weltweit gefragt, nutzbringend und heiß geliebt», ist der Museumsleiter überzeugt.
Jahrhundertelang war Porzellan in Europa teuerster Luxus, den sich nur Könige und Fürsten leisten konnten. Für das «Weiße Golde» aus China bezahlte der sächsische Kurfürst August der Starke sogar mit Soldaten. Im «Reich der Mitte» ist die Keramiktradition über 1000 Jahre alt. In Europa blieb die Herstellung dagegen lange ein Traum.
Erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts fanden Johann Friedrich Böttger und Ehrenfried Walther von Tschirnhaus die richtige Mischung aus Ton (Kaolin), Quarz und Feldspat. Im Jahr 1710 gründete August der Starke in Meißen die erste Manufaktur auf dem alten Kontinent. Die über 1000 Exponate beleuchten die Vielfältigkeit und Entwicklung des Porzellans vom Barock bis zur Gegenwart. Die Palette der Exponate reicht vom königlichen Geschirr bis zum modernen Badezimmer, von der teuren Skulptur bis zur elektrischen Lampenfassung.
Im Museum in Hohenberg an der Eger (Bayern) beleuchtet Kuratorin Petra Werner neun Stilepochen von der Gründung der ersten Manufakturen in Europa bis zum Art Déco. An einer fiktiven Tafel zeigt sie die Opulenz höfischer Tischsitten und pompöser Feste des Adels. Mit neuen Formgebungs- und Dekorationsverfahren wurde Porzellan später auch für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich. Die neue Wohnkultur demonstriert die Schau mit einer mit Sammlerstücken gefüllten Vitrine.
Zu sehen sind das Medici Porzellan, von dem es weltweit nur noch 60 Stücke gibt, Teile des vom Boden der Ostsee geborgenen Gedecks der russischen Zarin Katharina der Großen und Porzellane aus den berühmten Esterhazy-Sammlungen. Ein reich dekoriertes Wasch-Klosett aus Nussbaumholz und Porzellan gibt einen intimen Blick in die Toilette der österreichischen Kaiserin Sissy. Aus dem mittlerweile abgerissenen Berliner Palast der Republik stammen fünf großformatige Porzellanwandarbeiten, gefertigt von der ehemals volkseigenen Porzellan Manufaktur Meissen.
Im Museum in der ehemaligen Rosenthal-Fabrik in Selb zeigt der Chef des Pariser Centré Pompidou, Francoise Burkhardt, die Entwicklung des Designs von 1930 bis heute. Beispielhafte Namen sind der Finne Tappio Wirkkola, Luigi Colani, Jaspar Morrison, Wilhelm Wagenfeld und Philippe Starck. In den 80er Jahren kreieren auch Modeschöpfer wie Karl Lagerfeld, Pierre Cardin oder Paloma Picasso neue Formen und Dekore.
Von der Themeninsel «Lifestyle» führt der Weg weiter über Porzellan in der Architektur, Zukunftsvisionen von Absolventen verschiedener Hochschulen bis zum Bereich «Utopien des Alltags». Die Liste der Kuratoren reicht von Katia Baudin, der stellvertretenden Direktorin des Museums Ludwig in Köln, über Professor Hubert Kittel von der Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein in Halle, Marcello Morandini und dem internationalen Münchner Büro «Die Werft» bis zu Tido Brussig, der durch die Ausstellung «Schmuckwelten» in Pforzheim bekanntwurde.
Von der Jubiläumsausstellung erwartet sich die Branche auch eine Werbung für Porzellan «Made in Germany». Um im Wettbewerb mit asiatischen Massenproduzenten mithalten zu können, seien Flexibilität, Qualität und Innovationen gefragt, sagt der Geschäftsführer des Verbandes der Keramischen Industrie, Peter Frischholz.