Interview mit Historiker Heinz Schilling Interview mit Historiker Heinz Schilling: "Luther aus seiner Zeit heraus verstehen"
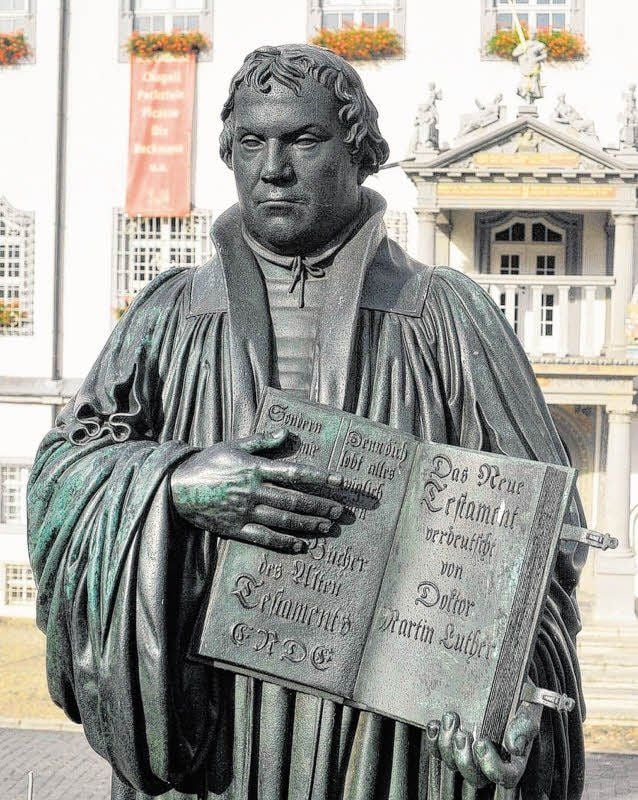
Halle (Saale) - Herr Professor Schilling, jede Zeit, jede Herrschaft hat sich ihr Luther-Bild gebaut. In der DDR reihte man ihn gar bei den Revolutionären ein. Jetzt lernen wir Luther neu kennen. Was hat Sie dahin geführt?
Schilling: Das fünfhundertjährige Reformationsgedächtnis 2017 ist eine Herausforderung an die Geschichtswissenschaft, eine Bestandsaufnahme unserer Kenntnisse zu den damals handelnden Personen, ihren Absichten und Taten sowie deren langfristigen Ergebnissen vorzulegen. Das bezieht sich auch auf Leben und Charakter des Reformators, zumal eine Biografie die Chance bietet, Personen und Strukturgeschichte miteinander zu verbinden, das Allgemeine in der Person zu veranschaulichen.
Dabei fühle ich mich verpflichtet, den Ereignissen und Personen möglichst nahe zu kommen. Wobei klar ist, dass auch der Historiker das aus seiner Zeit heraus tut. Bei Luther kommt hinzu, daß eine fünfhundertjährige Rezeptionsgeschichte gleichsam archäologisch zu erforschen ist.
Und wie muss man sich diese archäologische Arbeit vorstellen?
Schilling: Es wird dabei deutlich, dass jener Luther, den man seit Jahrzehnten vor Augen hatte, ein anderer ist als der, zu dem man dann vordringen wird. Man muss Schichten abtragen: Die aus der DDR, die von 1917, aus dem Ersten Weltkrieg. Und jene von 1933, als die Nazis nach Luther griffen.
Dann kann man beginnen, Luther aus seiner Zeit heraus zu verstehen. So findet man einen ganz anderen Mann als jenen, den man aus dem Konfirmandenunterricht kennt oder den die gängigen Luther-Bilder zeigen.
Mit welchem Ansatz sind Sie also an die Arbeit gegangen?
Schilling: Um Luther, seine Motive und seinen Handlungshorizont den heutigen Menschen überhaupt verständlich zu machen, war herauszuarbeiten, dass der Reformator in einer Zeit und mit einem Wertekanon agierte, die in den Grundprinzipien nicht mehr die unsrigen sind. Das heißt, es musste der „fremde“ Luther herausgearbeitet werden, um dann auf dieser Grundlage zeigen zu können, was von diesem Mann für uns heute noch relevant ist. Nicht umgekehrt also, indem wir den Blick darauf richten, welche Themen man denn bei Luther noch finden kann. Auf diese Weise bricht man immer nur die Steine heraus, die einem gerade passen.
Eine ordentliche Geschichtsbetrachtung ist zudem immer auch auf die Zukunft gerichtet - stärker als auf die Gegenwart. Sonst kann man gar nicht erkennen, welche Perspektiven es etwa für die Evangelische Kirche noch gibt.
Frühere Luther-Bilder haben tiefe Prägungen hinterlassen, zum Teil sind sie aus heutiger Sicht auch mit Scham besetzt.
Schilling: Lassen Sie mich hier auf Ihre Eingangsfrage zurückkommen. Ich glaube nicht, dass es immer nur ein Luther-Bild der jeweils Herrschenden gab. Es war da immer auch eine Schicht von Intellektuellen, von denen sich diese Herrscher beraten ließen - mit negativen wie positiven Auswirkungen. Das gilt für das wilhelminische Deutschland wie für die kommunistische DDR. Und das gilt in gewisser Weise auch heute noch.
1983 sah man in der DDR die Gelegenheit gekommen, mit der Luther-Ehrung international einen Punkt zu machen, was zum Teil auch gelungen ist. Doch zugleich hat die neue, intensive Beschäftigung mit Luther das Geschichtsbild der DDR und wohl auch ein wenig das der Herrschenden korrigiert.
Und wie sah es früher aus?
Schilling: Im ausgehenden 19. Jahrhundert ist es ähnlich gewesen, als Wissenschaftler das Luther-Bild der Zeit geprägt und in ihrer national-konservativen Weise die preußische Regierung unterstützt haben. Das heißt für 2017, Historiker, aber auch Journalisten sind hier in einer besonderen Verantwortung, Unterstützung zu geben, gegebenenfalls auch Widerspruch zu leisten, wenn es nach ihrer Ansicht in die falsche Richtung geht. Freilich sind es heute, in der pluralistischen Gesellschaft, nicht nur Wissenschaftler oder Intellektuelle, die das Luther-Bild prägen. Es wirken viele Kräfte, darunter auch die Interessen des Tourismus.
Hier stellt sich die Frage nach dem rechten Maß. Und wer bestimmt es?
Schilling: (lacht) Ich verweise auf die berühmten Luther-Socken. Sie kennen sie?
Ja.
Schilling: „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders“, steht darauf. Meine Assistenten haben mir welche geschenkt. Aber es gibt diese Socken bereits auch für Babys. Es ist dies ein Phänomen der Zeit, das man nicht verbieten kann. Wir leben ja in keiner gelenkten Demokratie. Entscheidend ist: Dies kann nicht das Einzige sein. Die Verantwortlichen für das Reformationsjubiläum im Jahr 2017 können sich natürlich freuen, wenn Menschen, denen Luther sonst nicht sonderlich nahe ist, auf die Märkte vor die Kirchen kommen.
Aber man darf auf dieser Welle nicht schwimmen, sondern muss deutlich machen, dass es für diese Popularisierung einen Kern dessen gibt, was Luther, was die Reformation bedeuten, und zwar über die Lutheraner und die Christen hinaus für die heutige Zivilgesellschaft. Hier bin ich nicht sicher, ob man schon den Mut dazu hat. Man könnte auch in den Luther-Ländern im Osten deutlicher über Religion sprechen, als man es bisher getan hat.
Sie plädieren hier also für eine Offensive der Religiosität?
Schilling: Für mich ist die Botschaft Luthers in die Neuzeit eine neu und existenziell verstandene Religiosität. Wenn man nicht den Mut hat, dies deutlich zu formulieren, hat man die Gelegenheit des Reformationsjubiläums versäumt.
Das heißt allerdings nicht, dass man zu der Religiosität Luthers zurückkehrt, die er als alleinige Wahrheit setzte. Es geht vielmehr darum zu zeigen, wie die Religion die Welt umgestaltet hat. Wie durch das reformatorische In-die-Welt-Wirken des Glaubens die neuzeitliche, säkulare und pluralistische Kultur der Gegenwart entstanden ist, und zwar nicht gegen, sondern durch die und mit der Religion. Das ist ein Kern, der jenseits aller verständlichen Ausnutzung dieses anstehenden Jahrestages herauszuarbeiten wäre.
Sie sind aber skeptisch?
Schilling: Man hört, die Evangelische Kirche in Deutschland plane, 95 Busse von Berlin aus durch Europa fahren zu lassen. Und jeder dieser Busse soll mit einer These zurückkommen. Das ist dann wieder so ein Event, der vom Kern ableitet. Und ich finde, dadurch wird es eben nicht gelingen, was doch angestrebt ist: Die Kirche wieder populärer zu machen.
Und vor allem wird mit der Re-Dogmatisierung der Reformation, die das jüngst vorgelegte EKD-Papier „Rechtfertigung und Freiheit“ methodisch und inhaltlich bestimmt, verfehlt, der politischen Öffentlichkeit die Bedeutung der Reformation und ihre Rolle bei der Entstehung der heutigen Zivilgesellschaft plausibel zu machen.
Jüngst ist ein Streit über die Bewertung der Reformation entstanden - aus der Kirchenleitung heraus.
Schilling: Der Grundlagentext der EKD zum Reformationsgedächtnis muss jeden allarmieren, der an einer breiten, auch die nicht-protestantischen und nicht-christlichen gesellschaftlichen Schichten berücksichtigenden Gestaltung des Reformationsjubiläums interessiert ist, die sich dem hohen Stand der auf Ereignisse des 20. Jahrhunderts bezogenen Gedächtniskultur Deutschlands stellt.
Daran arbeitet seit 2009 ein von Politik und Kirche berufener Wissenschaftlicher Beirat, den der damalige Bischof Wolfgang Huber initiierte. Mit der ad-Hoc-Kommission der EKD wurde eine Parallelstruktur errichtet und mit deren Reformationspapier nun eine Vision von Bedeutung und gegenwärtiger Relevanz der Reformation vorlegt, die eine Separation von der gesamtgesellschaftlichen Würdigung darstellt, selbst wenn das nicht die Absicht gewesen sein sollte.
Und so kann es nur die auf Abgrenzung ausgerichteten Falken im protestantischen Lager kalt lassen, wenn der ökumenefreundliche Kurienkardinal Kaspar über den Inhalt des EKD-Papiers „enttäuscht“ ist und sich „entsetzt“ zeigt, über „die Art und Weise, wie die Kritik namhafter evangelischer Reformationshistoriker zurückgewiesen wurde.“
Wie soll es weiter gehen?
Schilling: Mag sein, dass sich diese Gruppe aus solchen Verwerfungen eine Stärkung verspricht. Allen anderen muss daran gelegen sein, die Gräben rasch wieder zuzuwerfen, um zu der gemeinsamen Arbeit an einem sachgerechten Reformationsgedenken zurückzukehren, das Zukunft nicht verschließt, sondern über die protestantische Separat-Identität hinaus öffnet.
Luther steht dafür, seinen Glauben weiterzusagen. Kann es sein, dass die verbliebenen Christen ihren Luther zwar feiern wollen, sich aber scheuen, sich zu bekennen - zumal im Osten der Republik, wo die atheistische DDR noch nachwirkt?
Schilling: Das ist kein typisches Phänomen für den Osten, unter Intellektuellen im Westen ist es genauso gewesen. Dort hat man sich als bekennender Christ zwar in keine Gefahr begeben, hat sich keine Karriere verbaut, aber ein bisschen belächelt wurde man schon. Insbesondere an Universitäten galt es als komisch, auch wenn es dann akzeptiert worden ist.
Im Osten sind es zudem nicht zuletzt auch Christen gewesen, die an der friedlichen Revolution von 1989 beteiligt waren. Also sollten sie doch auch entsprechende Anerkennung genießen und sich selbstbewusst bekennen können.
Also mit Lutherscher Festigkeit?
Schilling: So wie Luther im 16. Jahrhundert, in der uns heute fremden Welt agiert hat, können Christen heute selbstverständlich nicht auftreten. Aber sein entschiedener Mut und sein Denken aus der Religion heraus haben eben welthistorisch gewirkt. Nicht jeder kann ein kleiner Luther sein, aber wir können schätzen, was dieser Mann geleistet hat.
Gleichzeitig können wir aber sagen: Luthers Art und Weise, das Christentum zu vertreten, ist nicht mehr die unsere. Obwohl er das nicht gewollt hätte, leben wir heute, nicht zuletzt in der Folge seines Wirkens, in einer säkularen und pluralen Gesellschaft. Und es liegt für das Jahr 2017 eine große Chance darin zu sagen: Es ist in dieser Gesellschaft nicht absurd, religiös zu sein. Und es ist lächerlich, wenn Nicht-Religiöse meinen, die Gläubigen als ewig Gestrige hinstellen zu können.
Sie stärken den evangelischen Christen also den Rücken.
Schilling: Gerade die Zentrierung auf die Religion hat zu bedeutenden Veränderungen in der Welt geführt - kultureller, aber auch politischer und ökonomischer Art. Deshalb hat die Religion, haben die Christen auch ein Recht, diese Gesellschaft mitzugestalten.
Was natürlich auch für gläubige Mitbürger anderer Religionen, insbesondere Juden, aber auch Muslime gilt. Die Vorstellung, die Integration von Muslimen könne nur gelingen, wenn sie ihre Fixierung auf die Religion aufgäben, ist ganz falsch.
Hier wird Religion mit militantem Verhalten verwechselt, das sich auf Religion beruft.
Schilling: Ja. Und hier können wir auch den Vergleich zu Luther ziehen. Er hat ja seine Religion radikal und absolut gelebt - und vertreten. Später hat die Christenheit Wege gefunden, dieses quasi fundamentalistsiche Absolut-Setzen der eigenen Wahrheit zu überwinden. Nicht gegen die Religion, sondern aus der religiösen Entwicklung heraus, zum Beispiel durch den Pietismus, der dann wesentlich die Wende zum Frieden im Dreißigjährigen Krieg mitgeprägt hat. Das heißt, die Religion selber hat dazu beigetragen, dass dieser militante Zug im Christentum überwunden werden konnte.
In ähnlicher Weise ist das in Bezug auf den Islam zu sehen. Es gibt Auswege, indem man diejenigen Elemente einer Religion stärkt, die sie aus der fundamentalistischen Sackgasse herausführen können.
Und wo liegt nun der Haken?
Schilling: Wir müssen versuchen, dem Menschen Gerechtigkeit entgegenzubringen, selbst im Zusammenhang mit diesen furchtbaren antijüdischen Schriften. Wir müssen fragen: Warum hat er das getan, welche Motive, aber auch Ängste standen dahinter? Wir müssen ihn aus der Zeit heraus, in der er gelebt hat, verstehen. In einer Konfirmandenzeitung las ich unlängst, Luther sei für den Holocaust verantwortlich. Das hat mich empört.
Ebenso falsch ist, wenn jetzt gesagt wird, wir hätten die Reformation zu feiern mit all ihren Weiterungen, die Person Luthers solle man dabei aber möglichst beiseite lasse. Denn er habe Schreckliches über die Juden gesagt, habe an Hexen und den Teufel geglaubt, nicht für die Emanzipation der Frauen gekämpft und – so möchte man ironisch hinzufügen – konnte nicht einmal Auto fahren. Nein – in unserer Kultur ist es ein Kernrecht des Menschen verstanden, nicht diffamiert zu werden. Das gilt auch für längst Verstorbene.
Sie sprachen vom Heiligen, den die Protestanten in Luther nicht sehen müssen. Für die Katholiken ist das Reformationsjubiläum hingegen wohl nicht so leicht zu verkraften?
Schilling: In meinen Augen ist es eigentlich ganz einfach, auch für die katholische Kirche. Man muß sich nur der Mühe historischer Grundlagenforschung unterziehen und bereit sein, die Menschen und die Situation des 16. Jahunderts zu verstehen. Aber Sie mögen schon Recht haben. Ich beobachte allerdings eine Polarisierung. Da ist zum einen ein ungeheures Interesse an meiner Luther-Biografie.
Also hat Luther bei den Katholiken Konjunktur?
Schilling: Mit Luther hat auch die katholische Kirche eine Erneuerung erfahren. Wenn wir dies nicht übersehen, sondern zusammenbringen, können wir vielleicht in ein neues Zusammenleben von Katholiken und Protestanten finden. Die früher in meiner Heimatstadt Köln übliche Praxis, dass Katholiken am Karfreitag die Teppiche klopften, während die Protestanten an Fronleichnam ähnlich verfuhren, gibt es schon lange nicht mehr.
Dem steht allerdings eine Gruppe insbesondere älterer Kardinäle gegenüber. Die empfinden das Reformationsjubiläum als eine geradezu schmerzhafte Geschichte, bei Luther handele es sich schließlich um einen Häretiker. Es wird nun letztlich darauf ankommen, wie der neue Papst Franziskus sich in dieser Frage positioniert.
Seine Vorgänger haben sich ja eher konservativ verhalten.
Schilling: Den Begriff konservativ würde ich in diesem Zusammenhang nicht gern verwenden. Was ich am neuen Papst sehe, mag er konservativ sein oder nicht: Er kommt aus einer ganz anderen Welt, aus Südamerika. Dort soll er unbefangene Kontakte zu Protestanten gehabt haben. Seine Vorgänger Johannes Paul II., ein Pole, und Benedikt XVI., der aus Bayern kommt, stammen aus dem alten Europa und wurden geprägt von den konfessionalistischen Bildern, vom Absetzen von den Protestanten. Das ist für den neuen Papst kein Problem mehr.
Sowohl für die Protestanten als auch für die Katholiken ist es nicht leicht, vernünftig mit dem lutherischen Erbe umzugehen. Wenn sich beide Seiten anstrengen, kann aus dem Jubiläum 2017 etwas werden - etwas, das in die Zukunft weist. Das ist das Entscheidende. (mz)





