Georg Trakl Georg Trakl: Neues Buch über einen ganz eigenartigen Dichter
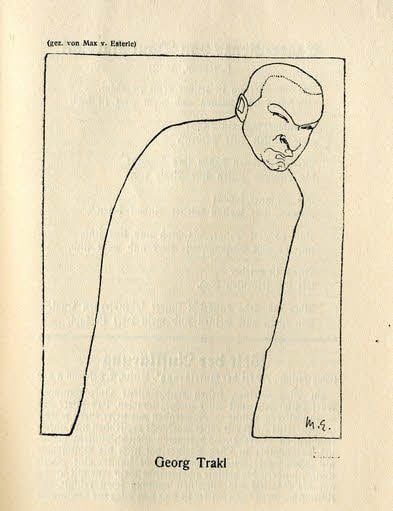
halle (Saale) - Heute vor 100 Jahren, Am 3. November 1914, ist der Salzburger Dichter Georg Trakl im Alter von 27 Jahren in einem Militärlazarett in Krakau gestorben. Er ist ein Opfer des Ersten Weltkriegs - trotzdem eine Überdosis Rauschgift, wissentlich oder unwissentlich eingenommen, zum Tod führte. Denn das letzte Ereignis, das Trakl durchleiden musste, war die Schlacht nahe der galizischen Stadt Gródek. In deren Folge musste sich der Sanitäter allein um 90 zum Teil schwer verletzte Kameraden kümmern. Ein Erlebnis, dass traumatisch fortwirkte und ihn als Patienten in die geschlossene Psychiatrie brachte.
Trakls letztes Gedicht heißt denn auch „Grodek“ und fasst, stark abstrahierend, die Schrecken des Krieges. Trakls letzte Lektüre waren Gedichte des schlesischen Barockdichters Johann Christian Günther, der auch mit 27 Jahren und ebenfalls fern der Heimat, in seinem Studienort Jena, starb. Beide sind bedeutende Lyriker, was aber erst später anerkannt wurde. Überliefert ist ferner, dass Trakl, als ihn sein Freund und Förderer Ludwig von Ficker im Krakauer Spital besuchte, Günthers Gedicht „Bußgedanken“ vorlas, das mit Versen anhebt, die sowohl auf Günther als auch auf Trakl passen: „Mein Gott! Wo ist denn schon der Lenz von meinen Jahren / So still, so unvermerkt, so zeitig hingefahren.“
Über Franz Fühmann zu Trakl
Wer in der DDR sozialisiert worden ist, könnte über Franz Fühmann zu Trakl gekommen sein. Der näherte sich im Essay „Vor Feuerschlünden – Erfahrung mit Georg Trakls Gedicht“ dem Werk des Österreichers autobiografisch.
Rüdiger Görner, der die Trakl-Biografie „Dichter im Jahrzehnt der Extreme“ vorlegte, nennt Fühmanns Werk „ein Meisterstück“, kommt aber auch zu dem Schluss, dass „Fühmann zuweilen die autobiografischen Begründungen für seine Trakl-Lektüre überzieht“. Görner wählt einen anderen Ansatz: Er nähert sich Georg Trakl ausschließlich über dessen Werk. „Trakl fällt aus nahezu allen Rahmen“, resümiert Görner. Sowohl menschlich als auch ästhetisch war der Dichter ein Einzelgänger.
Er gehörte keiner Gruppe an, er verkündete keine Manifeste und auch die Zahl seiner Auftritte ist überschaubar: Nur einmal hat Trakl öffentlich seine Gedichte vorgetragen. Die Lesung „dieses schon äußerlich ganz eigenartigen Menschen“, wie Görner aus einem Zeitungsbeitrag zitiert, war kein Erfolg. Dazu passt die Selbstauskunft des Dichters: „Mich verwirren die Dinge und die Menschen“.
Charakteristische Farb-Symbolik
Charakteristisch für die hermetischen Gedichte Trakls sind deren Farb-Symbolik und der weitgehende Verzicht, in diesen „ich“ zu sagen. Trakl hatte die Schule von Novalis, Hölderlin und Rimbaud durchlaufen, war ein Bewunderer Dostojewskis und wurde nachhaltig durch die Philosophie Nietzsches geprägt. Wie der Letztgenannte, so scheint auch Trakls bewusstes Leben in Geistestrübung geendet zu sein.
Im Krakauer Spital soll er zu Protokoll gegeben haben, dass er von einem Kardinal abstamme und in Zukunft „ein großer Herr“ sein werde. Das ist nicht weit entfernt von Nietzsches Wahnsinnsbriefen, die er 1889 mit „Der Gekreuzigte“ unterzeichnete. Viele Punkte in der kurzen Lebensgeschichte Trakls gaben Anlass zu Spekulationen. So etwa die viel diskutierte Frage, ob den Dichter ein inzestuöses Verhältnis mit seiner Schwester Grete verband.
Solchen Hypothesen gibt Rüdiger Görner weder Raum noch Nahrung. Dessen abwägendes Fazit lautet: „Man bleibt gut beraten, das Charakterbild dieses Dichters nicht abzuschließen. Denn zu vieles in seinem kurzen Leben verweigert sich der Biografie und darstellender Schlüssigkeit.“
Hermetische Dichtung
Wer meint, Trakls hermetische Dichtung entziehe sich dem Verständnis des Laien, der möge sich mit einem Satz des Philosophen Ludwig Wittgenstein trösten, der über Trakls Gedichte sagte: „Ich verstehe sie nicht; aber ihr Ton beglückt mich.“
Begleitet von kurzen Essays zu Themen aus Trakl Leben und Werk hat indes Gunnar Decker im Deutschen Kunstverlag eine Bildbiografie vorgelegt. Es überrascht, wie oft der menschenscheue Lyriker zeit seines kurzen Lebens abgelichtet wurde: Sei es 1907 als verhärmter Gymnasiast, 1912 im züchtigen Badeanzug und mit Zigarette am Lido in Venedig oder 1914 in Uniform, die rechte Hand lässig in der Hosentasche. Deckers Buch ist eine schöne Ergänzung zu Görners tiefgründiger Lebensbeschreibung. (mz)
Rüdiger Görner: „Georg Trakl - Dichter im Jahrzehnt der Extreme“, Zsolnay Verlag, 346 S., 24,90 Euro;
Gunnar Decker: „Georg Trakl“, Deutscher Kunstverlag, 95 S., 19,90 Euro




