Einar Schleef Einar Schleef: Deutung eines monologischen Monuments
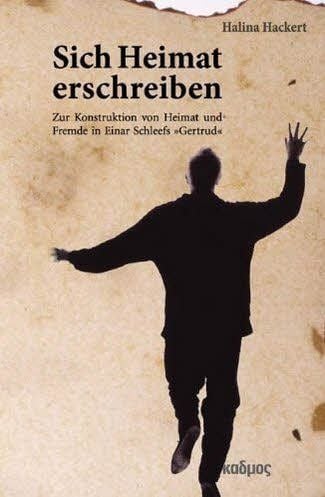
Halle/MZ - Man muss der DDR noch 23 Jahre nach ihrem Ende danken – denn sie hat den Theatermann Einar Schleef (1944-2001) zum Schriftsteller gemacht. Das geschah, wie sich denken lässt, eher unfreiwillig: Hätte die Ost-Berliner Politbürokratie den Bühnenbildner Schleef 1976 nicht aus dem Land geekelt, er hätte wohl kaum seinen Roman „Gertrud“ geschrieben, der 1981 und 1985 in zwei Bänden erschien – und fortan wie Blei in den Regalen lag.
Schleef war ein Künstler, der nicht untätig sein konnte. Also begann er im Westen, wo er über Jahre keine Arbeit an Theatern fand, sein Schreiben zu intensivieren. Am Ende des ersten Schreibrausches stand „Gertrud“. Die Germanistik hat über diesen Roman dreißig Jahre hinweggesehen. An diesem Fels wollte sich kein Wissenschaftler die Zähne ausbeißen, weil überall leichtere literarische Kost auf Analyse wartete.
Das ist bedauerlich. Denn kein zweiter Autor hat fertiggebracht, was Schleef gelang: Eine alte Frau – die wie Schleefs Mutter Gertrud heißt und wie diese in Sangerhausen lebt – einen an verbürgten Fakten derart umfangreichen Monolog führen zu lassen. „Gertrud“ bedient sich der gesprochenen Sprache mit dialektalen Einschüben und ist, weil wir Gertruds Gedanken folgen, sprunghaft vom Anfang bis zum Ende. Ganz nebenbei wird auch noch ein Jahrhundert deutscher Geschichte porträtiert. Kurz: Als Schriftsteller gibt sich Schleef so wie als Theatermacher: ausufernd und kompromisslos.
Halina Hackert ist, so weit sich sehen lässt, die erste Germanistin, die die Mühe auf sich genommen hat, dieses sperrige Muttermonument - das „die Provinz bis in die kleinsten Verästelungen fast schon schmerzhaft realistisch beschreibt“ - einer an Genauigkeit kaum zu überbietenden Interpretation zu unterziehen. Ihre Ausführungen sollten auch die größten Skeptiker davon überzeugen, dass Einar Schleefs „Gertrud“ eine in der deutschen Literatur einzigartige, weil unerreichte Dichtung ist.




