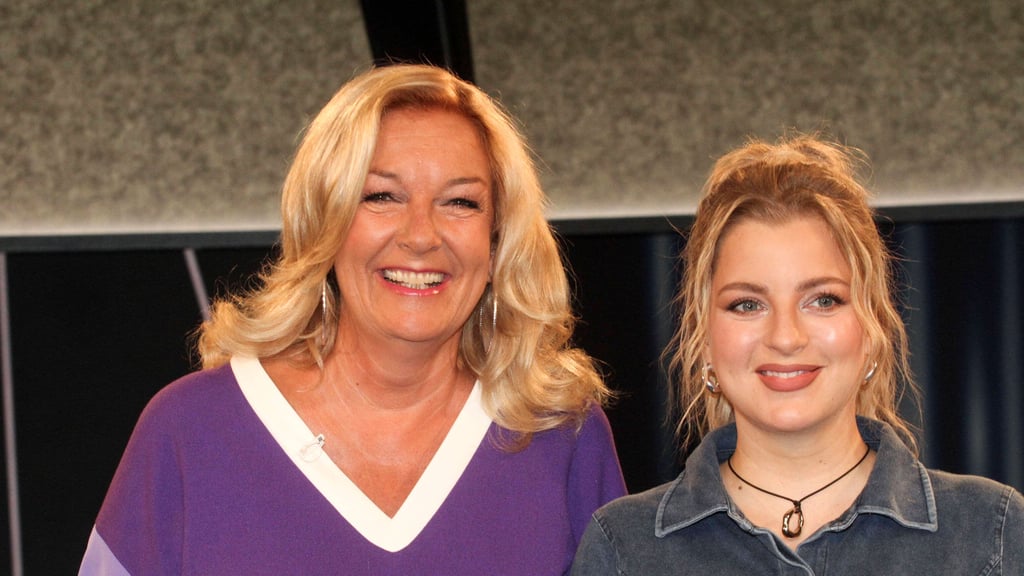Carl-Krayl-Ausstellung in Magdeburg Carl-Krayl-Ausstellung in Magdeburg: Farbenfroh in die Moderne

Magdeburg - In Friedrich Nietzsches philosophischer Dichtung „Also sprach Zarathustra“ zieht der Titelheld in eine Stadt namens „Bunte Kuh“. Ob die farbig ist, wird nicht mitgeteilt.
Carl Krayl machte aus Magdeburg aber tatsächlich jene „bunte Stadt“, die Anfang der 1920er Jahre dafür sorgte, der – seinerzeit von der Schwerindustrie geprägten – grauen Metropole ebenso ein neues Image zu verleihen wie das Neue Bauen, dessen wichtigster Akteur in der Elbestadt ebenfalls Krayl war.
Das Kulturhistorische Museum Magdeburg würdigt das Werk des wegweisenden Architekten jetzt erstmals mit einer Ausstellung, die Teil des Ausstellungsverbundes „Große Pläne! Die angewandte Moderne in Sachsen-Anhalt 1919-1933“ ist.
Carl Krayl, der 1890 im schwäbischen Weinsberg geboren wurde und 1947 in Werder (Havel) starb, prägte in den 20er und beginnenden 30er Jahren die städtebauliche Metamorphose Magdeburgs, erst als angestellter Architekt der städtischen Baubehörde, ab 1924 als freier Architekt. Der als Star-Architekt der 20er Jahre geltende Bruno Taut, der 1921 zum Stadtbaurat in Magdeburg ernannt worden war, holte Krayl an die Elbe. Fortan war der Schwabe Tauts rechte Hand im Hochbauamt. Krayls erstes Projekt war es, die Stadt in Farbe erstrahlen zu lassen.
Im Schatten seines Mentors Taut
Im Zuge der Aktion „bunte Stadt“ wurden rund 80 Hausfassaden koloriert, allein 35 Entwürfe für Wandbemalungen lieferte Krayl. Die farbenfrohe Kampagne war Teil der Mitteldeutschen Ausstellung Magdeburg 1922 im Rotehornpark, für die Krayl im Auftrag des Schokoladenherstellers Hauswaldt auch einen expressionistischen Pavillon entwarf, der auf der Messe temporär als Kakao-Trinkhalle fungierte.
Krayls Herkunft vom Expressionismus zeigt in der Magdeburger Schau auch sein kristalliner Entwurf für das Hygiene-Museum Dresden, den er 1920 bei einem entsprechenden Wettbewerb einreichte. Dieser blieb freilich ebenso eine Vision auf Papier wie viele andere seiner Entwürfe in dieser Zeit.
In seinem 1921 im Stadtteil Reform bezogenen Reihenhaus, das sein Kollege Taut entworfen hatte, konnte sich der Künstler im Architekten hingegen ausleben: Die Wohnräume hat Krayl abstrakt-expressiv ausgemalt. Selbst vor den Möbeln in der guten Stube machte seine Farbenfreude nicht halt.
Auf die Frage, warum Bruno Taut als städtebaulicher Reformer in Magdeburg so präsent, Carl Krayl hingegen vergessen ist, antwortet Kurator Michael Stöneberg: „Taut war als Städteplaner der Wegbereiter und als Architekt eine Lichtgestalt, in dessen Schatten Krayl lange Zeit gestanden hat.“
So spektakulär Krayls Architekturvisionen auch waren, erst mit der Hinwendung zum neusachlichen Bauen entwickelte er architektonische Lösungen, die in Form und Funktion umsetzbar waren. Dazu zählen jene maßvoll konzipierten Siedlungen mit Sozialwohnungen in Magdeburg, die, angesichts steigender Einwohnerzahlen, in den 1920er Jahren wie Pilze aus dem Boden schossen.
Zwischen 1919 und 1932 entstanden unter Mithilfe Krayls 12 000 Wohnungen: An der Bauhütte-Siedlung war er ebenso beteiligt wie bei der Curie-Siedlung und der Siedlung Cracau. Auch das wird in der Schau mit Zeichnungen, Fotografien, Modellen und informativen Texten gut nachvollziehbar erklärt.
Als Krayls Magdeburger Meisterwerk gilt das Gebäude der Allgemeinen Ortskrankenkasse in der Lüneburger Straße. Hier schuf der Architekt (anfangs noch mit seinem Büropartner Maximilian Worm) 1926 „einen vollkommen neuen Bautypus: ein medizinisches Zentrum mit großräumigen Serviceeinrichtungen“, wie Ute Maasberg im vorzüglichen Begleitbuch erläutert.
Großzügig und kühn
Die heutige AOK-Zentrale für Sachsen-Anhalt war zur Erbauungszeit ein Gesundheitszentrum, das, großzügig und kühn im Umgang mit Material und Konstruktion, in der Fachwelt für Furore sorgte.
Als Architekt, der durch seine Magdeburger Entwürfe ein prominenter Vertreter des Neuen Bauens war, bekam Krayl nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten, die eine radikal antimoderne Baukunst propagierten, keine Aufträge mehr. Der letzte Entwurf, den er in Magdeburg realisieren konnte, hatte private Auftraggeber: Er gestaltete 1936 die Olvenstedter Lichtspiele (OLi).
Wenige Monate darauf kam Krayl bei der Bauleitung der Reichsbahn in Berlin unter, wo er im Heer jener Stadtplaner tätig war, die in Hitlers Auftrag und unter Albert Speers Leitung jene Welthauptstadt Germania entwarfen, die Berlin dereinst werden sollte. Welch bittere Ironie: Vom selbstbewussten und gefeierten Vertreter des Neuen Bauens wurde Krayl zum Gestalter von Nazi-Architektur – nachdem auch der Versuch, seinem Mentor Taut als Mitarbeiter ins türkische Exil zu folgen, im Sande verlaufen war.
„Bunte Stadt – Neues Bauen:Die Baukunst von Carl Krayl“, bis 12. Februar im Kulturhistorischen Museum Magdeburg, Otto-von-Guericke-Straße 68, Di-Fr 10-17 Uhr, Sa/So 10-18 Uhr.
Das Begleitbuch kostet 39,90 Euro. (mz)