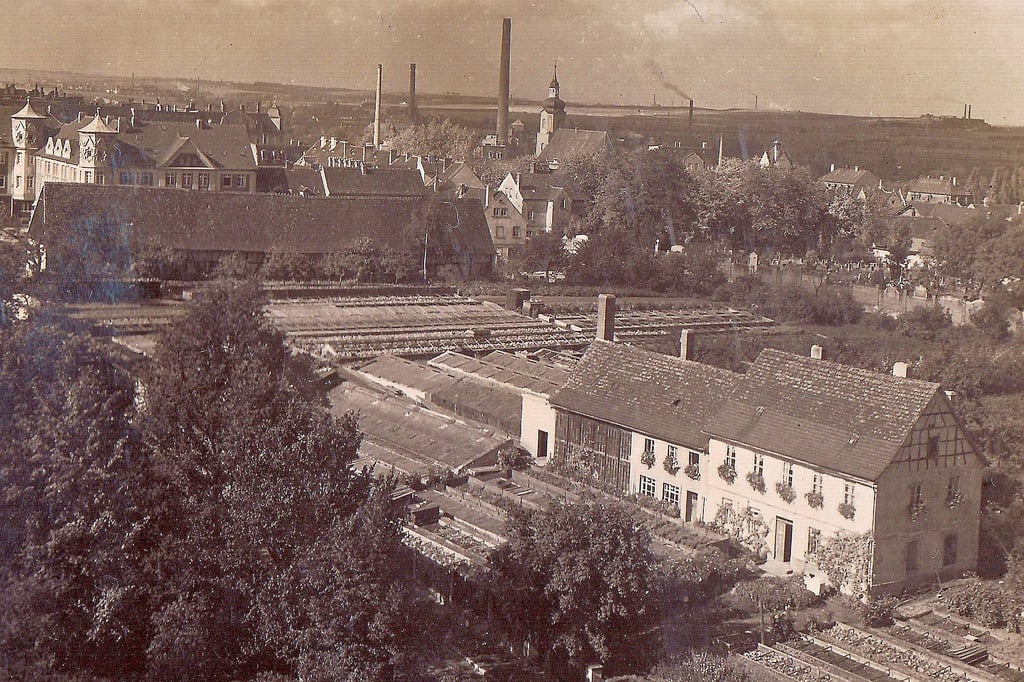Alexander Kluge Alexander Kluge: "Wir müssen Mut erzeugen"

München - Alexander Kluges Arbeitswohnung in München-Schwabing ist ein weiträumiges Ineinander von Büro, Bibliothek und Filmstudio. Vor dem Computer, an dem Kluge die Korrekturen zu einem neuen Buch liest, liegt ein Band Klopstock. Kein Zufall. Am Donnerstag erhält der 87-Jährige in Quedlinburg den Klopstock-Preis für neue Literatur des Landes Sachsen-Anhalt. Mit Alexander Kluge sprach unser Redakteur Christian Eger.
Herr Kluge, Sie sagen von sich, dass Sie nach Mitteldeutschland gehören, egal, wer das Land gerade beherrscht oder verwaltet. Woher rührt diese Zuneigung?
Alexander Kluge: Mein Vater, meine Mutter, meine Großeltern, meine Urgroßeltern, die einen kamen von Eisleben, die anderen von Halberstadt. Dort habe ich bis zum 13. Lebensjahr gelebt, das prägt. Ich bin jetzt zwar etwas älter geworden, aber in meinem Herzen hat sich überhaupt nichts verändert. Wenn ich an meine Kindheit denke, dann ist das so wie: Jetzt.
Was meinen Sie, wenn Sie von Mitteldeutschland reden?
Kluge: Das Gegenteil von Großdeutschland. Ostpreußen und Bayern hatten nie etwas wirklich miteinander zu tun.
Wie grenzen Sie das ein, Mitteldeutschland?
Kluge: Gar nicht. Da gehört viel Slawisches dazu. Kulturell sind Prag, Leipzig, Halberstadt, Magdeburg miteinander verwandt.
Mitteldeutschland war das Grenzland nach Osten.
Kluge: Ein Laboratorium für Neues. Das fängt mit Otto dem Großen an, mit dem Bistum Halberstadt und dem Erzbistum Magdeburg, die eine ganze Kultur ausbreiten. Die reicht von Odessa bis nach Frankreich. Die Bildung der Antike kam über die mitteldeutschen Domschulen zu uns. Später steht die mitteldeutsche Aufklärung im 18. Jahrhundert mit an der Spitze und zwar als eine Basisbewegung. Die kam von unten, von den sogenannten Sekretären her: Die ließen die Äcker florieren, brachten moderne Getreidesorten ins Land. Sie setzten auf die Natur ein Stück Zivilisation. Das waren echte Gärtner.
Was ist von dieser Kultur geblieben?
Kluge: Manches. Aber es ist ein bisschen in den Untergrund gegangen. Zuletzt durch die sehr harten Eingriffe der Marktgesellschaft und der Treuhand. Aber im Untergrund, im Gemüt, erbt sich so was über die Generationen weg.
Es gibt ein mitteldeutsches Gemüt?
Kluge: Da bin ich ganz sicher. Das ist nicht gegen etwas gerichtet. Es ist eine besondere Bearbeitungsform dessen, was in der Welt geschieht.
Wie kann man das beschreiben?
Kluge: Es ist im Grunde subversiv.
Wie steht es zur Obrigkeit?
Kluge: Absolut skeptisch. Gehe nicht zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. Die besten Witze gegen Hitler wurden auf dem Gebiet meiner Heimat erzählt.
Wo bis 1945 die deutsche Mitte war, ist seitdem der Osten. Ihr Vater hatte bis 1979 in Halberstadt gelebt, wo Sie ihn häufig besuchten. Wie haben Sie die DDR wahrgenommen?
Kluge: Oben war Planwirtschaft bis zum Lachanfall und unten eine Energie, die ermöglichte, dass es trotzdem klappt. Es gibt ein ostdeutsches Reparaturgenie, das genauso zur Industrie gehört wie das Erfinden von Patenten. Entgegengesetzt zu den Algorithmen von Silicon Valley schwöre ich auf den Reparaturinstinkt, und den kenne ich aus meiner Heimat.
Was fehlt Ihnen, wenn heute vom Osten geredet wird?
Kluge: Zunächst einmal ist da etwas zu viel und das sind die Phrasen. Die Sonntagsphrasen braucht man nicht. Dieses Schönreden. Es gibt Phänomene, die man auch benennen muss, wo etwas im Grunde zerstört wurde, aktiv zerstört wurde. Die Marktgesellschaft ist disruptiv und sie hat in der überschnellen Abwertung der DDR-Industrie, nur weil sie anders war, Verwüstungen angerichtet. Hier etwas neu zu pflanzen, das wäre das Wesentliche, das fehlt mir.
In der FAZ war dieser Tage zu lesen, dass es einen Grund für die ostdeutsche Lage gäbe, das sei die „westdeutsche Besitzstandswahrung“.
Kluge: Und das ist ja wahr. Die Fabriken in Mitteldeutschland, diese feinmechanische Kenntnis mitsamt den Menschen dort, hätte man genauso gut retten können. Das war Misswirtschaft. Aber auf diese Rücksichtslosigkeit und Kälte kann man heute auch anders antworten. Nicht mit Gutmütigkeit, sondern mit Erfindungsreichtum. Ich glaube, dass diese mitteldeutschen Erfahrungen nicht vorübergegangen sind. Auf jede Schandtat von 1990, auf jeden Webfehler damals, werden wir in der siebten Generation in denselben Landstrichen eine Antwort finden. Die wird anders aussehen als einfach die Unterwerfung unter Fakten.
Vor 30 Jahren ging das Volk auf die Straße. Wenn heute von 1989 gesprochen wird, ist nur vom Mauerfall die Rede. Wäre nicht vielmehr von der Revolution zu sprechen?
Kluge: Absolut, der Mauerfall gehört zu den Sonntagsphrasen. Das holt man alle fünf Jahre wieder hoch. Die Revolution ist das Wichtige und das sind die Runden Tische. Die sind etwas Bewundernswertes. An deren Impulse sollten wir heute zu jedem Tages- und Nachtzeitpunkt erinnern und sie fortsetzen.
Im Osten steht die AfD vor Wahlerfolgen.
Kluge: Adorno sagt, dass Menschen, die leiden, die sich ausgegrenzt fühlen, nach rechts gehen.
Warum?
Kluge: Weil das leicht ist. Der psychologisch nächste, aber langfristig teuerste Griff heißt: Die Anderen sind Schuld. Der Westen, die Globalisierung, die Fremden vor allem. Man muss versuchen, die Gründe für diese Mischung an Gefühlen und Motiven, die sich hier versammeln, auf ihre Elemente zurückzuführen und zu unterscheiden lernen. Was man nicht billigen kann, muss man trotzdem zu verstehen suchen. Der Prozess der Aufklärung ist nach wie vor das einzige, was hilft. Verstand, Herz und Witz. Nicht Phrasen dreschen. Das ist die homöopathische Methode, wenn Sie so wollen. Mit der chirurgischen werden wir mit der Rechten nie fertig.
Was hilft politisch?
Kluge: Rein politisch muss man rote Linien ziehen. Aber das reicht nicht im Leben. Da sind Vereine, das sind Familien, Irrtümer, aber auch Sorgen. Ich kann mir Familien vorstellen, in denen ein Linker und ein AfD-Mitglied direkt aufeinander stoßen. Friedrich Schiller und Bert Brecht könnten über eine solche Szene ein Stück schreiben. Und auf dieser Elementarebene kann es Auswege geben, die helfen, dass wir wieder unsere Mitte finden.
Eine Politik von unten?
Kluge: Ja, und zwar am liebsten vom Gemüt her. Durch Menschen, die das Bedürfnis haben, etwas vor Ort zu ändern. Wir brauchen einen republikanischen Geist. Ein neues Narrativ, das sich auf Regionen, Vereine, Basisorganisationen gründet. Wir müssen Mut erzeugen und dann ergeben sich auch die Auswege.
Herr Kluge, Sie werden im Namen Klopstocks geehrt. Ein Autor, der Ihnen etwas sagt?
Kluge: Er sagt mir sehr viel. Wie Gleim in Halberstadt war er ein Pflanzer von literarischer, spiritueller Kommunikation. Ohne Klopstocks Öffnung der Literatur kein Heinrich von Kleist, kein Hölderlin, auch Teile von Schiller nicht.
Geöffnet hat Klopstock hin zur Lebenswirklichkeit?
Kluge: Nein, zu den Worten hin. Rebellion der Worte. Die Worte sind aufsässig bei ihm, die gehorchen nicht. Worte tragen keinen Sattel. Ich kann mich nicht in jede Gläubigkeit des 18. Jahrhunderts einfühlen, ich habe eine aus dem 21. Jahrhundert. Ich habe zur Liebe ein anderes Verhältnis als in Klopstocks „Elegien“ beschrieben wird. Ich bin nicht ganz so schwärmerisch, nicht so wortreich. Das ändert aber gar nichts daran, dass er innige Töne hat. Das übersetze ich mir ins 21. Jahrhundert. So etwas müssen Sie in der Literatur dauernd machen. Wenn ich Ovids „Metamorphosen“ lese, ist das für mich Gegenwart. Dieser Autor ist nicht 2 000 Jahre tot, sondern vorgestern gerade geboren. (mz)
Preisverleihung: Quedlinburg, 22.8.2019, 19 Uhr, Hotel Schlossmühle. Eintritt frei