Albert Einstein Albert Einstein: Deutschland feiert den Stein der Weisen für Wissenschaft
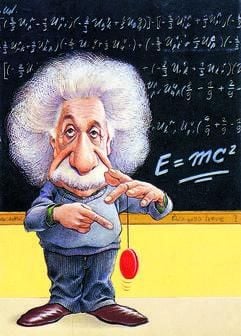
Halle/MZ. - Der 75-jährige Hausherr spricht oft Deutsch und entschuldigt sich dafür. Er sagt, dass Mozarts "Nachtmusik" sein Lieblingsstück sei, viel mehr aber eigentlich auch nicht. Bald verabschiedet sich Einstein, um wieder seinen Schreibtisch zu erreichen. Griffin, der sich bereit erklärt, den Damen beim Abwasch zu helfen, unkt der Weltstar hinterher, dass Männer in Europa so eine Zuarbeit ablehnen würden.
Dumm gelaufen. Dann huscht der Alte doch noch einmal die Treppenstufen herab, um dem verstörten Griffin sein Lieblingsspielzeug vorzuführen: einen Plastikvogel mit Saugnäpfen. Einstein zieht den Vogel auf, lässt ihn am Flurspiegel hinaufklettern, bis er überkippt. Dann fängt er das Tierchen auf - mit einem Kichern, das tief von Innen kommt. "Gefällt ihnen das?" fragt Einstein. Ja, sagt Griffin - und von diesem Moment an gehört der Gast zu den letzten engen Freundes des Genies, das im April vor 50 Jahren gestorben ist.
Wozu die Schnurre? Sie führt an die Persönlichkeit Einsteins heran, die ja auch in diesem Jahr gefeiert werden soll. Denn das ist alles nur schwer voneinander zu trennen: der Wissenschaftler, der Politiker und der Popstar Albert Einstein.
Der Plastikvogel zeigt den Humor des 1879 in Ulm geborenen Unternehmersohnes, der von 1919 an - mit der Bestätigung der von ihm vorhergesagten Lichtkrümmung durch die Sonnenmasse - ein Weltstar gewesen ist. Humor war Einsteins Mittel, sich die Zumutungen der Mitwelt vom Leib zu halten, eben auch jene Selbstanfragen, die sich der eigenen seelischen Verfasstheit verdanken. Der Physiker hielt wenig von der Psychoanalyse - sehr viel aber vom "Spiel" in allen Varianten. Er ist ein Kindsmann gewesen, der zeitlebens als ein kleiner Prinz durch die Welt gezogen ist - so egozentrisch auch und unanfechtbar, schwer zu ertragen oft für die Nächsten.
"Woher kommt es, dass mich niemand versteht und jeder mag?" Diese Frage hat sich Einstein selbst gestellt, und von nächster Woche an werden wir in dieser Sache offiziell geschult. Mit staatlich verordneter Neugier sozusagen, denn die Bundesregierung hat der Welt das "Einsteinjahr" erklärt, das Gerhard Schröder am 19. Januar in Berlin eröffnen wird. 13 Millionen Euro stehen bereit für die Aktion "Lust auf Zukunft". Warum 2005? Weil im sogenannten Wunderjahr 1905 der 26-jährige Einstein seine Spezielle Relativitätstheorie und weitere grundlegende physikalische Forschungen veröffentlicht hat.
Noch wer wenig Lust auf Zukunft hat (Einstein: "Ich sorge mich nicht um die Zukunft. Sie kommt früh genug."), kann seine Lust auf Einstein decken oder überhaupt erst entfachen. Denn dieser Mann ist in keinem Aspekt seiner Persönlichkeit ein durchschnittlicher Charakter gewesen. Die Relativitätstheorie, die die Lichtgeschwindigkeit anstelle von Newtons "Raum und Zeit" als Naturkonstante setzt, bleibt in ihren theoretischen und faktischen Weiterungen ein atemberaubender Roman - mit offenem Ausgang. Einsteins Weltanschauungs-Publizistik, erstmals 1934 im Exil vorgelegt, ist eine Lektüre von hoher Originalität, Tapferkeit, erfrischender Schlichtheit auch.
Prima, dass einer unter der Zeile "Wie ich die Welt sehe" schreibt. Ein Autor, den man mit dem Rotstift lesen will: "Wozu Socken? Sie schaffen nur Löcher!" Und: "Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher." Einstein 2005: Es wird ein gutes Jahr.




