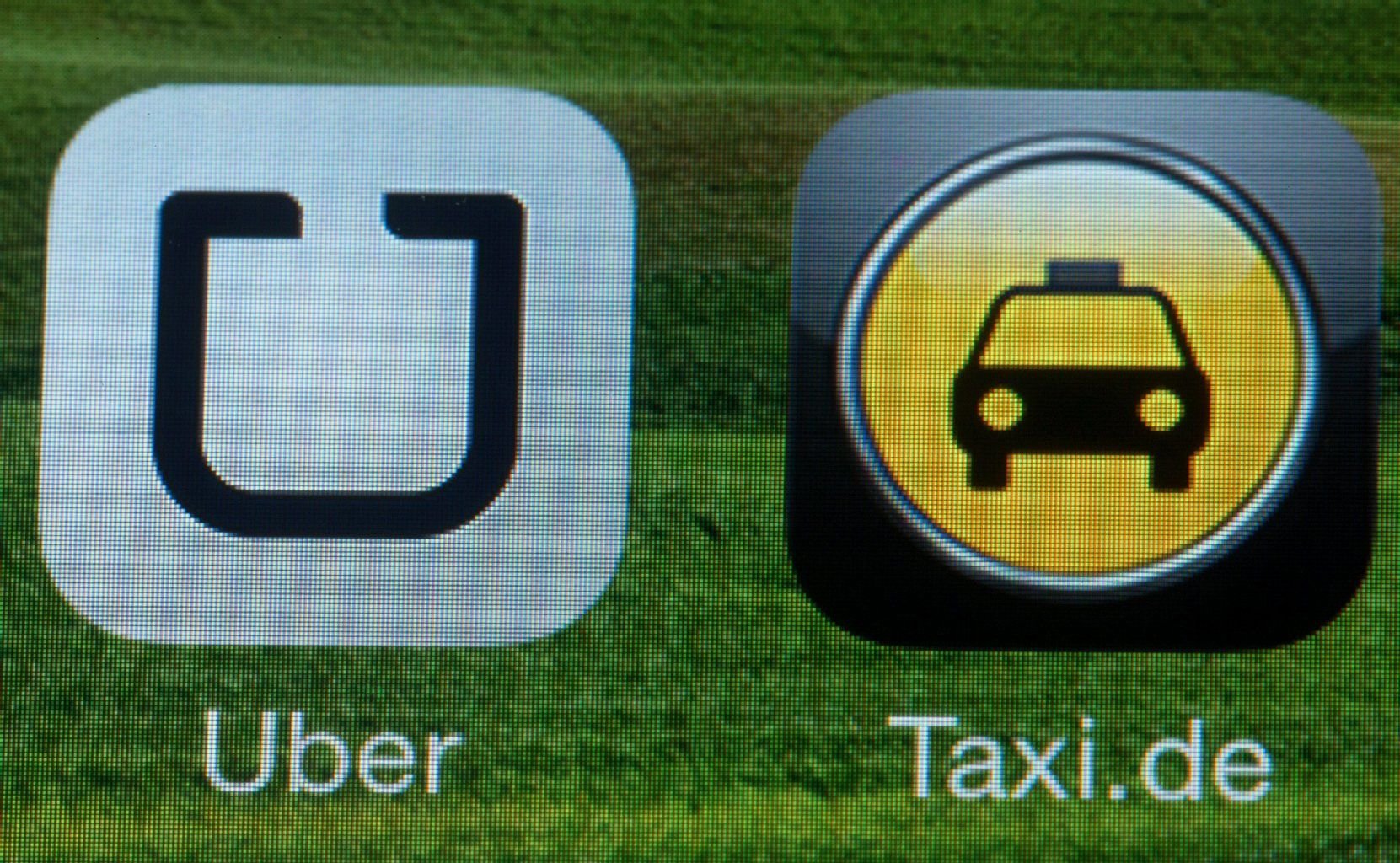Fahrdienst Fahrdienst: Wie es nach dem Uber-Verbot weitergeht

Frankfurt - Trotz eines Verbots durch das Frankfurter Landgericht will der umstrittene Fahrdienstvermittler Uber der Taxi-Branche weiter Konkurrenz machen. Der US-amerikanische Transportapp-Betreiber erklärte, einer einstweilige Verfügung vom vergangenen Dienstag ignorieren zu wollen. Uber setzte den Betrieb am Dienstag fort. „Fortschritt lässt sich nicht ausbremsen“, erklärte der US-Konzern.
Wir erklären, was hinter seiner Strategie steckt und welche Handhabe die Taxibranche nun hat.
Was genau hat das Landgericht entschieden?
In einem Eilverfahren erließen die Richter eine einstweilige Verfügung, wonach Uber über seinen Dienst „UberPop“ in ganz Deutschland ab sofort keine entgeltpflichtigen Beförderungswünsche mehr von Fahrgästen an Fahrer vermitteln darf, die nicht über eine offizielle Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz verfügen. Bei einem Verstoß droht das Gericht der Firma ein Ordnungsgeld von 250.000 Euro je Fahrt an – „ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollstrecken an ihrem Direktor“. Der Beschluss erging bereits am vergangenen Donnerstag ohne mündliche Verhandlung, wurde aber erst jetzt bekannt. Bis zum Beginn einer mündlichen Verhandlung ist die einstweilige Verfügung auf jeden Fall gültig. Nicht betroffen ist der Dienst „Uber Black“, über den Limousinen mit professionellen Fahrern vermittelt werden.
Wer hat die einstweilige Verfügung erwirkt?
Antragssteller ist die Taxi Deutschland Servicegesellschaft für Taxizentralen. Sie ist ein bundesweiter, genossenschaftlicher Zusammenschluss und betreibt unter anderem die Smartphone-App „Taxi Deutschland“ sowie die mobile Taxirufnummer 22456. Die Taxi-Branche fühlt sich durch das Geschäftsmodell von Uber herausgefordert: Das Unternehmen vermittelt über seine Apps unter anderem kostenpflichtige Stadtfahrten an private Autofahrer, die über keine amtliche Erlaubnis zum Personentransport verfügen. Die Fahrten sind deutlich billiger als die offiziellen Taxis. Nach eigenen Angaben ist Uber weltweit bereits in mehr als 200 Metropolen aktiv. In Deutschland bietet das Unternehmen seine Dienste in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Düsseldorf an. Sieben weitere Städte sollen folgen. Uber argumentiert bei Rechtsstreitigkeiten stets, gar nicht als Personenbeförderer, sondern nur als Vermittler aufzutreten. Uber hat seinen Sitz in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien. Antragsgegner in dem Frankfurter Verfahren ist die europäische Niederlassung Uber B.V., die in Amsterdam ansässig ist.
Was unterscheidet den Frankfurter Beschluss von bisherigen Uber-Verboten?
Die zuständigen Landesämter in Berlin und Hamburg haben Uber bereits von sich aus untersagt, seine Dienste anzubieten. In Berlin muss das Unternehmen aber nicht mit Vollstreckungsmaßnahmen rechnen, bis das Verwaltungsgericht über seinen Widerspruch entschieden hat. In Hamburg hatte das dortige Verwaltungsgericht in der vergangenen Woche entschieden, dass die Untersagungsverfügung der Wirtschaftsbehörde aus formellen Gründen nicht rechtens sei. Die Behörde will aber so schnell wie möglich die nächste Instanz anrufen. Im Frankfurter Fall hatte nun Taxi Deutschland beim Landgericht direkt beantragt, Uber die Fahrtvermittlung an Privatpersonen zu verbieten. Auf der Grundlage einer EU-Verordnung ist das Landgericht befugt, das Unternehmen bundesweit in die Schranken zu weisen. Und zwar deshalb, weil es seine Dienstleistung auch in Frankfurt am Main anbietet – „so dass der Erfolgsort der unerlaubten Handlung u.a. im hiesigen Gerichtsbezirk ist“, heißt es in dem Beschluss.
Wie reagiert Uber auf das Verbot?
Uber zeigt sich – wie bei den bisherigen Verboten in Berlin und Hamburg auch – komplett unbeeindruckt. „Uber wird seine Tätigkeit in ganz Deutschland fortführen und wird weiterhin die Optionen uberPOP und UberBlack über die Uber App anbieten,“ teilte das Unternehmen mit. Ein klarer Verstoß gegen den Beschluss.
Wird die Polizei nun Uber-Fahrer stoppen?
Nein. Es handelt sich um einen Zivilprozess. Weder Staatsanwaltschaft noch Polizei wird deshalb von sich aus tätig werden. Der Antragssteller, also die Taxi Deutschland Servicegesellschaft für Taxizentralen, muss das Ordnungsgeld zunächst beantragen (das ist für jeden Verstoß, also jede vermittelte Fahrt möglich). Die Höhe wird dann von der 3. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main festgesetzt. Maximal darf es 250.000 Euro betragen. Im Normalfall liegt es aber bei einem ersten Verstoß deutlich darunter, zu erwarten ist eine niedrige fünfstellige Summe. Bis Uber tatsächlich eine solche Summe zahlen muss, kann es ohnehin dauern. Dem Vernehmen nach dauert es auch bei einem Eilverfahren mindestens vier Wochen.
Muss Uber auf jeden Fall zahlen?
Nein. Auch wenn es vor Gericht unstreitig sein wird, dass Uber gegen den Beschluss verstößt, da der Konzern das offen erklärt, kann Uber die Aussetzung der Vollstreckungsmaßnahmen beantragen. Es kann erwartet werden, dass Uber – ebenso wie bereits in Berlin und Hamburg – auch in Frankfurt diesen Weg wählt. Bleibt es auch nach der Verhandlung bei dem Verbot von Uber, kann der US-Konzern vor das Oberlandesgericht Frankfurt ziehen. Bis zu einer Entscheidung dort werden in jedem Fall mehrere Monate vergehen.
Worauf zielt Ubers Strategie?
Uber setzt auf rasante Expansion solange die Verfahren in den Gerichten noch andauern. Der Dienst will zeigen, dass es eine Nachfrage gibt. Dann nämlich, so Ubers Strategie, erhöht sich der Druck, ihn auch erlauben. Am Tag nach dem bundesweiten Verbot, das das Landgericht Frankfurt am 25.8. erlassen hat, erklärte Uber daher prompt, die Kapazitäten in Deutschland bis Jahresende noch einmal verdoppeln zu wollen. In Berlin, München, Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf gibt es den Dienst bereits. Als nächstes soll die Expansion nach Köln und Stuttgart, anschließend wohl auch nach Nürnberg, Bonn, Essen, Dortmund und Potsdam erfolgen. In allen Städten gebe es bereits tausende Anmeldungen für den Uber-Dienst.
Wie reagieren die Taxibranche und Uber?
„Wir haben damit, gerechnet dass Uber, den Beschluss ignoriert“, sagte Anja Floetenmeyer, Sprecherin von Taxi Deutschland, das den Beschluss erwirkt hatte, im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie kündigte an, dass Taxi Deutschland das Ordnungsgeld beantragen werde. Das werde allerdings nicht in den nächsten zwei Tagen passieren, da Taxi Deutschland dazu gerichtsverwertbare Beweise vorlegen muss. „Wir werden über UberPOP Fahrten buchen und dann bei den Behörden überprüfen lassen, ob für das Fahrzeug eine Konzession vorliegt und ob der Fahrer einen gültigen Personenbeförderungsschein hat.“ Floetenmeyer weiter: „Wir haben einen langen Atem.“
Der Vorsitzende Dieter Schlenker sagte, im deutschen Personenbeförderungsgesetz seien Fahrer- und Verbraucherschutz geregelt. „Das kann kein noch so neoliberales Unternehmen einfach aushebeln.“ Schlenker weiter: „Uber arbeitet mit Milliarden-Kapital von Goldman Sachs und Google, hüllt sich in einen Startup-Look und verkauft sich als New-Economy-Heilsbringer.“ Das Unternehmen kassiere, ohne zu investieren und übernehme keine Verantwortung für die Fahrer, die Fahrgäste und die Fahrzeuge. Uber hingegen teilte mit: „Wir werden die Entscheidung angreifen und unsere Rechte mit Nachdruck und aufs Äußerste verteidigen.“ Das Unternehmen werde seine Tätigkeit in ganz Deutschland fortführen. „Die Wahlmöglichkeiten der Bevölkerung einzuschränken, war noch nie eine gute Idee.“
Was hat es mit dem Personenbeförderungsgesetz auf sich?
Das Gesetz schreibt unter anderem vor, dass eine entgeltliche oder geschäftsmäßige Beförderung von Personen in Deutschland einer amtlichen Genehmigung bedarf. Diese Genehmigung ist immer an umfangreiche Auflagen gebunden. Wer ein Fahrzeug zur Personenbeförderung steuert – also beispielsweise ein Taxi – braucht auch einen speziellen Befähigungsnachweis dafür, den so genannten Personenbeförderungsschein. Um ihn zu erhalten, müssen die Antragssteller unter anderem Ortskenntnisse und gesundheitliche Eignung nachweisen. Notwendig ist auch ein amtliches Führungszeugnis und ein Auszug aus dem Verkehrszentralregister des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Insgesamt können Kosten von mehreren hundert Euro entstehen.