Zuwanderung von Bulgaren und Rumänen Zuwanderung von Bulgaren und Rumänen: Deutsche Städte befürchten Probleme
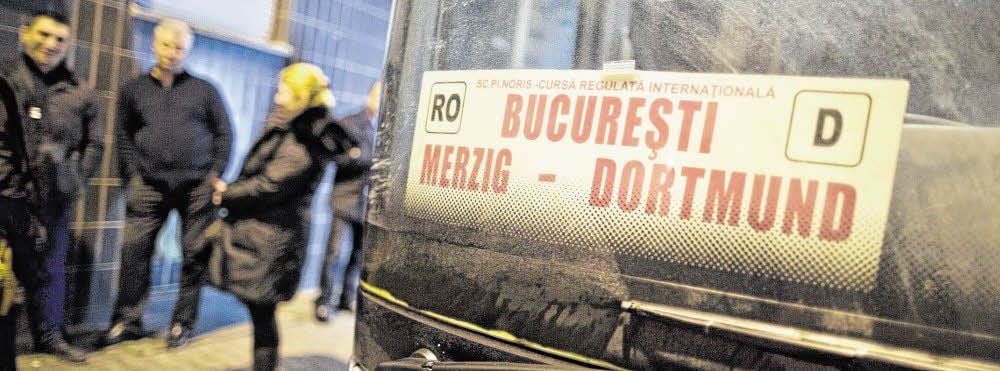
Dortmund/MZ - In der Dortmunder Nordstadt stößt Europa an seine Grenzen. Die drei Männer am Nordmarkt drücken sich schon seit Stunden im Hauseingang an der Ecke Schleswiger Straße/Mallinckrodtstraße herum. Auf Deutschlands wohl bekanntestem Arbeiterstrich, der inzwischen selbst für den Kommunalwahlkampf der CSU in Bayern herhalten muss, gibt es für die Tagelöhner aus dem bulgarischen Plovdiv so kurz nach Neujahr nichts zu tun. Auf den Großbaustellen wird trotz der frühlingshaften Temperaturen noch nicht gearbeitet, ein einziger Kleinlaster hat am Morgen angehalten und zwei ihrer Kollegen aufgepickt. Irgendein mieser Job in einem Abbruchhaus im Ruhrgebiet, vermutlich für drei Euro die Stunde.
Drei Kaffee in der Trinkhalle gegenüber, dazu ein Tee für den Landsmann, der gebrochen Deutsch spricht. Der muss erst einmal ein Missverständnis aufklären. Ein Zeitungsreporter? Das haben die Männer missverstanden. Sie hatten gehofft, doch noch einen Job zu kriegen, irgendwo Werbezeitungen und Prospekte austragen zu können. Ein Arbeitsangebot, das die Tagelöhner, die zum Teil weder lesen noch schreiben können, nur ganz selten erreicht.
Man könne sich ja ein wenig unterhalten. Aber Namen tun nichts zur Sache, übersetzt der Landsmann und schlürft seinen Tee. Die Bitte nach einem Foto wird sofort abgelehnt. Nicht auszuschließen, dass der Übersetzer am Elend der Armutszuwanderer noch verdient. Als Vermittler von Jobs oder Schlafplätzen in einem der vielen heruntergekommenen Mietshäuser aus der Gründerzeit rund um den Nordmarkt.
Elend, miese Jobs? Aus den wenigen Sätzen, die sich den schweigsamen Männern entlocken lassen, lässt sich eins schnell herauslesen. Für sie gibt es keine miesen Jobs. Jeder Job ist grundsätzlich gut. Egal, wie schlecht er bezahlt wird. Zehn Stunden Arbeit auf einer Baustelle bedeuten einen Verdienst zwischen 30 und 50 Euro am Tag. Da können in guten Monaten durchaus mal 1 000 Euro zusammenkommen. Ein Großteil davon wird nach Hause geschickt. Im Januar jedoch wird diese Rechnung schon nicht mehr aufgehen. Vor der Trinkhalle stoppt eine Polizeistreife, das Ordnungsamt ist zwischen dem Nordmarkt und dem Borsigplatz auffällig präsent, doch dabei geht es nicht um den Arbeiterstrich, sondern um die Folgen, die ein Viertel bewältigen muss, wenn es zum Zielquartier der Armutswanderung geworden ist: Überbelegung von Häusern, Lärmbelästigung, Müllproblematik und kriminelle Aktivitäten.
Birgit Zoerner ist weit davon entfernt, diese Probleme schönzureden. Dortmunds Sozialdezernentin sitzt in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die sich seit mehr als einem Jahr mit der Armutszuwanderung aus Südosteuropa beschäftigt, sie ist die Sprecherin des Deutschen Städtetags in Sachen Zuwanderung von Rumänen und Bulgaren. Die gebürtige Dortmunderin hält es für nicht zielführend, Fragen des Hartz-IV-Anspruchs und des Sozialhilfemissbrauchs in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen. Bis der Europäische Gerichtshof über die Frage, ob arbeitssuchenden EU-Bürgern die gleichen Rechte auf Sozialleistungen wie Bundesbürgern zustehen, nicht entschieden habe, seien die Regeln klar. Anspruch auf Hartz IV haben Zuwanderer erst, wenn sie einen sozialversicherungspflichtigen Job hatten und arbeitslos geworden sind.
Wüste Spekulationen
Auch an Vorhersagen, wie sich die seit dem 1. Januar geltende volle Freizügigkeit auf die Zuwanderungszahlen für Dortmund auswirken wird, will sich Zoerner nicht beteiligen. „Das sind doch alles nur wüste Spekulationen.“ Sie hält sich lieber an die Fakten. Es sei immerhin ein Fortschritt, dass die Politik offenbar langsam begreife, was das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Ende Dezember noch einmal festgestellt habe.
Die Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit kommt in einer Studie zu dem Ergebnis, dass sich die Armutszuwanderung aus Bulgarien und Rumänien auf einige strukturschwache Städte wie Dortmund, Duisburg und Berlin konzentriere. „Hier sind nicht nur die Arbeitslosen- und Leistungsempfängerquoten sehr hoch“, so die Experten. In den betroffenen Städten seien 60 bis 75 Prozent der Bulgaren und Rumänen „weder erwerbstätig noch im Leistungsbezug“.
Für eine Stadt wie Dortmund ist das eine große Herausforderung. „Wir hatten im letzten Jahr per saldo eine monatliche Zuwanderung von 110 Menschen aus Bulgarien und Rumänien. Da sind Zuzug und Wegzug eingerechnet“, erklärt Zoerner. Derzeit lebten rund 4 500 in Dortmund, der mit 578 000 Einwohnern drittgrößten Stadt in Nordrhein-Westfalen. „Die Gruppe der Rumänen ist die größere.“ Die Stadt habe sich entschieden, 2014 als „Sortierungsjahr“ zu bezeichnen. „Wir haben die Prognosen, die 2013 auf den Markt kamen, mehrfach hin und her diskutiert. Es kann keiner seriös abschätzen, wie viele tatsächlich noch kommen werden.“
Forscher erwarten 2014 in Deutschland bis zu 180 000 Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien. Die Zahl der Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien könnte durch den Wegfall der Beschränkungen nach Schätzungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bei der Bundesagentur für Arbeit 2014 um 100 000 bis 180 000 steigen. Im Oktober 2013 lebten 262 000 Rumänen und 145 000 Bulgaren in Deutschland. Die Erwerbstätigenquote lag bei 60 Prozent, die Arbeitslosenquote unter dem Bevölkerungsdurchschnitt.
In Duisburg mit seinen 487 000 Einwohnern ist die Lage noch problematischer. Anfang Dezember waren dort 9 600 Bulgaren und Rumänen gemeldet, mehr als doppelt so viele wie in Dortmund. Pro Monat kommen 650 hinzu. Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD) warnt seit langem vor negativen Folgen für die betroffenen Stadtbezirke, wenn es nicht gelänge, die Zuwanderer in die Stadt zu integrieren. Das sogenannte Problemhaus von Rheinhausen, in dessen drei Wohnblöcken nach Schätzungen zwischen 600 und 1 500 Menschen leben, hatte im vergangenen Jahr europaweit für Schlagzeilen gesorgt.
Keine einfachen Lösungen
Duisburgs Oberbürgermeister weiß, dass es „keine einfachen Lösungen gibt“. Link hofft, dass sich die Probleme der Überbelegung und Verwahrlosung in Häusern, die eigentlich nicht vermarktungsfähig sind, durch das geplante neue Wohnungsaufsichtsgesetz abmildern lassen. Bisher dürfen die Kommunen nur einschreiten, wenn die Mieter sie darum bitten, was in den Elendsquartieren noch nicht einmal vorgekommen ist. Auch in Dortmund sieht man das geplante Gesetz positiv, ein Allheilmittel sei es aber keineswegs. Es sei nur ein Instrument, um gegen „ausbeuterische Vermieter-Strukturen vorzugehen“, sagt Birgit Zoerner.
„Wir müssen endlich zur Kenntnis nehmen, dass ein Großteil dieser Menschen hierbleiben wird“, sagt die Sozialdezernentin. Deshalb gibt es zur Integration überhaupt keine Alternative. Die Menschen müssen letztlich hier eine Arbeit finden, mit der sie ihren Lebensunterhalt verdienen können.“ In einer hoch verschuldeten Stadt wie Dortmund mit hoher Arbeitslosigkeit und einem großen Anteil schlecht qualifizierter Menschen, die schon jetzt auf dem Arbeitsmarkt keine Chance haben, erscheint dieser Weg ausgesprochen schwierig. „Dessen sind wir uns absolut bewusst.“
Enorme Kraftanstrengung
Dennoch habe man vor einigen Monaten damit begonnen, die Strukturen aufzubauen. „Wir achten sehr darauf, dass alle schulpflichtigen Kinder auch zur Schule gehen. Auch wenn das eine enorme Kraftanstrengung ist.“ Zwar stünden die Schulen gerade in den betroffenen Stadtbezirken mit hoher Zuwanderungsrate kurz vor der Kapazitätsgrenze, aber an der Schulpflicht werde nicht gerüttelt. „Uns wäre sehr geholfen, die Auszahlung des Kindergelds an die Erfüllung der Schulpflicht zu binden. Alle Kommunen halten das für den richtigen Weg. Warum der Bund sich selbst nach dem Regierungswechsel da nicht bewegt, ist mir ein Rätsel“, sagt Zoerner.
An der Fachhochschule Dortmund wird es demnächst einen dualen Studiengang Armutszuwanderung geben. Von den 30 Studenten, die später einmal Sozialarbeiter werden sollen, sollen zehn aus Bulgarien und Rumänien kommen. „Das mussten wir machen, denn die Sozialarbeiter hatten mit diesen Themen bisher ja nichts zu tun“, erklärt Zoerner. Spracherwerb, Gesundheitsvorsorge, berufliche Bildung - das alles wird viel Geld verschlingen.
Duisburgs Oberbürgermeister fordert, dass der Bund die Folgekosten der Europapolitik für die Kommunen übernimmt. In Dortmund sieht man das ähnlich. „Die Leute werden bleiben, und wenn man sich nicht darum kümmert, nimmt man in Kauf, dass dann tatsächlich eine Parallelwelt entsteht“, sagt die Sozialdezernentin. „Die Kommunen brauchen kein folgenloses Getöse, sondern konkrete Hilfe auch vom Bund, um die Probleme lösen zu können.“




