Kommentar zu 100 Tagen Kommentar zu 100 Tagen: Große Koalition ist ein labiles und hysterisches Bündnis
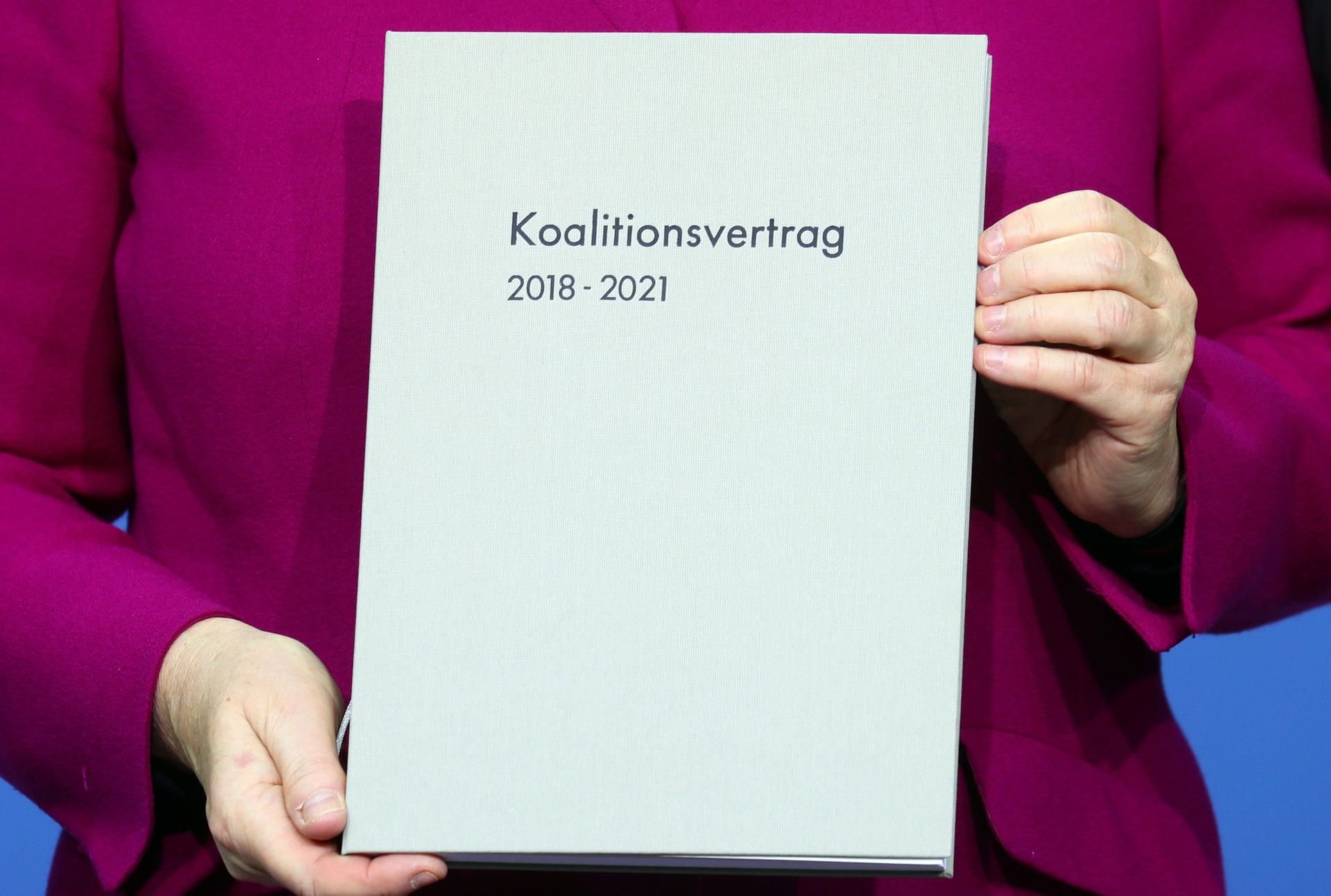
Berlin - Es war einmal eine Zeit, da galten große Koalitionen als träge, aber stabil. Einhundert Tage nach Gründung der vierten schwarz-roten Bundesregierung hat man eher den gegenteiligen Eindruck: statt langweilig und solide wirkt die große Koalition hysterisch und labil; was früher als Hort der Stabilität galt, klingt eher nach Kinderhort.
Noch immer wächst einfach nicht zusammen, was doch eben noch zusammengehört hatte: eine Union mit sozialdemokratischem Anstrich und eine SPD mit Agenda- und Groko-Profil. Zwar hatte der Koalitionsvertrag verdeutlicht, dass die schwarz-rote Notlösungsgemeinschaft zu keiner großen Vision mehr fähig war: Kein Ministerium für Digitales, keins für Integration und keine Ideen für Europa, die den Schwung eines Emmanuel Macron aufgenommen hätten.
Völlig verschiedene Ziele
Angesichts des aktuellen Asylstreits drängt sich aber eine noch schwerwiegendere Diagnose auf: Die drei Partner des Bündnisses haben haben völlig verschiedene Ziele, die einander oft genug widersprechen.
Das wiegt schwerer als Fragen von Stil und Professionalität, über die angesichts der aggressiven Sabotage, die die CSU als kleinster Koalitionspartner derzeit betreibt, auch zu reden wäre. Damit sind nicht die üblichen Uneinigkeiten gemeint, die sich darin zeigen, dass etwa in der Klimapolitik, bei der Belebung der ländlichen Regionen und beim Internetausbau noch immer nichts vorangeht.
Bittere Wahrheiten
Vielmehr treten einige bittere Wahrheiten zutage – bitter jedenfalls für alle, die diese neue große Koalition als vielleicht letzte Chance begriffen haben, dem Durchmarsch des Populismus auch in Deutschland noch etwas entgegenzusetzen. Das naheliegendste dieser Erkenntnisse ist, dass die Auswirkungen der Flüchtlingskrise von 2015 auf die deutsche Politik längst noch nicht verdaut sind.
Doch es ist nicht allein die CSU, der das Flüchtlingsthema noch unter den Nägeln brennt, auch bei den Bürgern gibt es kaum ein politisches Thema, das so hitzig diskutiert wird. Das mag auch daran liegen, dass andere Probleme zu kompliziert sind, um sich im Alltag darüber aufzuregen. Aber einen so anhaltenden Gesprächsbedarf können weder TV-Talkshows, noch Minister-Stänkereien allein auslösen.
Selbst bei der CSU hat die Eskalation des Themas ihren Grund nicht nur in Sturheit, Trotz und Angst vor Wählerflucht zur AfD. Vielmehr haben die drei Koalitionäre verschiedene Schlüsse daraus gezogen, dass sie im Herbst ihre schlechtesten Wahlergebnisse seit Jahrzehnten eingefahren haben.
Auch ihre Analysen, wie der Vertrauenskrise gegenüber Politik und Medien, ja der Krise der gesamten liberalen Demokratie beizukommen sei, unterscheiden sich grundlegend: Das ist die Wurzel des üblen Bildes, das die große Koalition gerade abgibt.
Den simpelsten Lösungsansatz verfolgt die CSU, die wie schon zu Zeiten von Franz Josef Strauß versucht, die Wähler am rechten Rand zu integrieren. Dafür agiert sie längst so populistisch wie Trump persönlich. Bislang ist diese Taktik im Kampf gegen Rechtsradikale wie NPD und Republikaner aufgegangen.
Für diese Strategie zahlten sie später in den 90er Jahren den Preis, das Asylrecht faktisch abzuschaffen. Diesen Preis war damals auch die CDU bereit zu zahlen. Unter Merkel versuchen die Christdemokraten inzwischen, konstruktiver vorzugehen. Dem Krawall von Rechts wollen sie das Bekenntnis zu Europa und eine Botschaft von innerer und äußerer Sicherheit entgegensetzen, um AfD & Co. die Möglichkeit zu nehmen, entsprechende Sorgen auszuschlachten.
Doch sowohl in Europa, als auch auf anderen Kontinenten geben längst Populisten und Autokraten derart den Ton an, dass dieser Plan nicht aufgeht – und Merkel nicht einmal mehr von ihrem alten Ruf als Krisenmanagerin profitieren kann.
SPD kann nicht punkten
Die Sozialdemokraten schließlich haben aus der Wahl die eigentlich plausible Lehre gezogen, dass Abstiegsängste und soziale Ungleichheit die tiefere Ursache dafür sind, dass so viele Deutsche sich von der SPD und anderen Etablierten abwenden.
Gerade die ersten Wochen der neuen großen Koalition nutzten die Sozialdemokraten deshalb für den Start zahlreicher Projekte, die den Deutschen ganz konkret helfen sollen: das Rückkehrrecht von Teilzeit- in Vollzeitjobs, höheres Kindergeld, die gleichberechtigte Finanzierung der Krankenkassen durch Arbeitgeber. Allein, weder den Umfragewerten der SPD, noch dem Ruf der Groko oder der Stimmung im Land hat das geholfen.
Als Bündnis aus der Zeit gefallen?
Es wäre eine besonders bittere Erkenntnis, wenn sich auch diese Analyse als falsch herausstellte: dass es den Menschen nur gut gehen muss, damit sie an Demokratie, Weltoffenheit und Hilfsbereitschaft glauben. Dann würden Deutschland und Europa erst wieder in ruhigere Fahrwasser geraten, wenn die EU eine Festung ist und abgehängte wie bürgerliche Wähler das Gefühl haben, wieder in einem Nationalstaat alter Prägung zu leben.
Wenn es so wäre, wäre der Grund für die Krise der Groko, dass sie als Bündnis schon aus der Zeit gefallen ist – und dass uns noch weitaus dunklere Zeiten bevorstehen.




