Firmengeschichte Dr. Oetker Firmengeschichte Dr. Oetker: NS-Vergangenheit aufgearbeitet
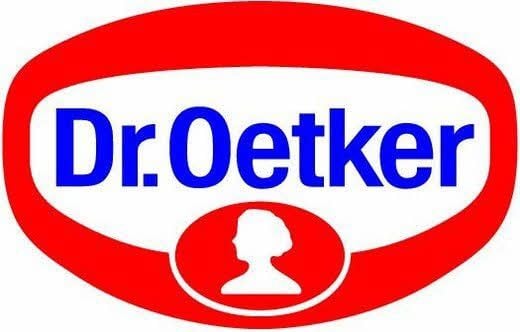
berlin/MZ - Oetker’s Hellkopf, der Schattenriss als Markenzeichen, hat die Zeiten überdauert. Weiß auf rotem Grund ziert er Backpulvertütchen und Fertigsuppen der Dr. August Oetker KG – inzwischen ein weltweit operierendes Unternehmen, das sich längst nicht mehr nur auf die Herstellung von Backpulver versteht.
Ein heller Kopf war auch Richard Kaselowsky, Fabrikantensohn aus Bielefeld, der das Oetker-Unternehmen von 1919 bis 1944 führte. Unter seiner Leitung florierte die Firma, expandierte im In- und Ausland, in Friedens- und in Kriegszeiten. Rudolf-August Oetker, Enkel des Firmengründers und Stiefsohn Kaselowskys, war deshalb mit sich im Reinen, als er der Stadt Bielefeld 1959 eine Kunsthalle stiftete und sie nach seinem Stiefvater „Richard-Kaselowsky-Haus“ nannte.
Bei ihrer Eröffnung, knapp zehn Jahre später, wurde dieser Name zum Skandal. Bielefelds außerparlamentarische Opposition nahm Anstoß daran, die Kunsthalle nach einem Mann zu benennen, der sich zum Freundeskreis des Reichsführers SS, Heinrich Himmler gezählt hatte. Zur Eröffnung geladene Gäste sagten ihre Teilnahme ab. Der Komponist Hans-Werner Henze zog sein zur Eröffnung komponiertes Klavierkonzert zurück. Die Eröffnungsfeier fiel aus.
Oetker sprach von einem „politischen Irrtum“ seines Vaters aber auch von seinen „schwerer wiegenden Verdiensten“. Die Kunsthalle hieß noch bis 1998 Richard-Kaselowsky-Haus. Und noch länger, 45 Jahre, dauerte es bis die Historiker Jürgen Finger, Sven Keller und Andreas Wirsching vom Oetker-Konzern damit beauftragt wurden, die Rolle Kaselowskys und des Unternehmens im Nationalsozialismus zu untersuchen. Ihr Buch „Dr. Oetker und der Nationalsozialismus“ kommt zu dem Schluss, dass sich nicht nur Kaselowsky, sondern mit ihm die gesamte Familie Oetker in den Dienst der Nationalsozialisten gestellt hatte.
„Zwischen Oetker und das Regime passte kein Blatt Papier“, erklärte Andreas Wirsching. Nicht nur gehörte Kaselowsky zu den Unterstützern der NSDAP, deren Mitglied er seit 1933 war, die Familie bereicherte sich überdies an „Arisierungen“. Wirsching ist Lehrstuhlinhaber für neuere und neuste Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität und Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München. Kaselowsky stehe exemplarisch für die Entwicklung eines konservativen Liberalen zum glühenden Anhänger des Nationalsozialismus, so Wirsching. Moralische Vorbehalte, etwa gegen die antijüdische Hetze des NS-Regimes, existierten allenfalls noch in Abwehrreflexen. Auf den Boykott jüdischer Geschäfte im April 1933 etwa reagierte das Unternehmen in einem Rundschreiben an Geschäftsfreunde: „Der Judaismus hat durch seine Kapitalmacht einen starken, z.T. aber schädigenden Geisteseinfluss durch Presse und Literatur gewonnen, und es bedeutet deshalb eine an sich beispiellose Tatenentschlossenheit, wenn die junge deutsche Erneuerungsbewegung den Kampf mit dieser Macht aufgenommen hat.“ Richard Kaselowsky, der sich im Freundeskreis Reichsführer SS gut aufgehoben fühlte, hatte keine Skrupel, die Familie Oetker und das Unternehmen an der Arisierung jüdischer Firmen und jüdischen Privateigentums zu beteiligen. Die Villa des jüdischen Direktors der Hamburger Zigarettenfirma Reemtsma erwarb Kaselowsky über die Vermittlung einer Grundstücksverwaltung von Reemtsma. Zu einem „normalen“ Preis, wie die Firma Oetker betonte, als sich der frühere Besitzer, Kurt Heldern, 1948 um eine Rückerstattung bemühte. Die Autoren werten den Kauf der Villa dennoch als „Arisierung“. Neben weiteren „Gelegenheiten“, Privateigentum zu erwerben, bemühte sich Kaselowsky auch um Firmen-Arisierungen, bevorzugte dabei den Erwerb von Aktien.
„Wir als Familie müssen hinnehmen, dass die handelnden Personen damals das System bejaht und unterstützt haben“, erklärte der Firmenerbe August Oetker zum Erscheinen der Firmengeschichte. „Die objektive und vorbehaltlose Aufarbeitung dieses Kapitels unserer Unternehmensgeschichte lässt indes keine Mutmaßungen oder Missdeutungen über unsere Vergangenheit mehr zu.“ Das ist immerhin mehr, als andere deutsche Unternehmen von sich behaupten können. Oetker will sie als Mahnung verstanden wissen, sich für eine „offene, freie Gesellschaft“ einzusetzen.




