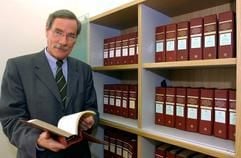50 Jahre Bundesverwaltungsgericht 50 Jahre Bundesverwaltungsgericht: Richter sind die Kontrollinstanz über den Staat

Leipzig/dpa. - Als das Bundesverwaltungsgericht vor 50 Jahrenseine Arbeit aufnahm, wurde ein Novum geschaffen. Erstmals gab eseine bundesweite Kontrollinstanz über den Staat und Bürger konntenihr Recht ihm gegenüber einfordern. Nach der Herrschaft des Nazi-Regimes war dies von besonderer Bedeutung. Symbolkraft hatte dabeider Standort des Gerichts: West-Berlin. 50 Jahre später ist dasGericht in einer anderen Stadt angekommen: in Leipzig, der Stadt derMontagsdemonstrationen. Wieder ein Symbol für Demokratie.
«Und wieder ein Sitz, der nicht unumstritten war», sagtGerichtspräsident Eckart Hien im Vorfeld des Festaktes zum 50-jährigen Bestehen am 13. Juni in Leipzig. Rechtshistorisch betrachtethätte der 1895 als Reichsgericht eröffnete Monumentalbau demBundesgerichtshof zugestanden. Doch die Karlsruher Richter wehrtensich erfolgreich gegen einen Umzug, nur ihre Kollegen des in Berlinansässigen 5. Strafsenats konnten sich mit einem neuen Dienstsitz inder Messestadt anfreunden.
Die Verwaltungsrichter unter ihrem damaligen Präsidenten EverhardtFranßen reagierten flexibler. Im August 2002 setzten sie denBeschluss der Föderalismuskommission von Bundestag und Bundesrat von1992 um und zogen mit mehr als 60 Richtern und rund 230 Mitarbeiternin das für knapp 55 Millionen Euro sanierte Haus. Damit wurde nach 57Jahren wieder Recht gesprochen in dem geschichtsträchtigen Bau, dernach der düsteren NS-Zeit und dem Reichstagsbrandprozess zu DDR-Zeiten als Museum genutzt wurde.
Nach Ansicht des heutigen, achten Präsidenten passt der neue Sitzdurchaus für das oberste Verwaltungsgericht. «Denn dieses Gebäudesteht für die Einheit des Rechts», sagt Hien. Diese Vereinheitlichunghat das Gericht in seinen ersten Jahren geprägt. Lange bevorVerfahrensregeln zum Gesetz wurden, haben sie die Richter in denkarmesinroten Roben entwickelt. Weitere Themen der ersten Stundenwaren das Beamtenrecht und der Lastenausgleich. Themen, die sich nachder Wiedervereinigung 1990 in leicht abgewandelter Form wiederholten.Wieder ging es um die Übernahme politisch belasteter Beamter odervermögensrechtliche Streitigkeiten.
Exakt 181 646 Verfahren hat das Gericht, das zwei Wochen vor demVolksaufstand am 17. Juni 1953 seinen Dienst aufnahm, bis Ende 2002entschieden. Besondere Schwerpunkte ergaben sich dabei mit derWiedervereinigung, beispielsweise durch Verfahren zu denVerkehrsprojekten Deutsche Einheit.
Und immer wieder sorgte das Bundesgericht mit seinenEntscheidungen für Wirbel. Beispielsweise mit dem so genanntenKopftuch-Urteil vom Juli 2002, das jetzt das Bundesverfassungsgerichtbeschäftigt. Oder der Fall «Mehmet» im selben Jahr, als der mehrfachstraffällig gewordene und deshalb ausgewiesene Jugendliche nachDeutschland zurück durfte. Zuletzt sorgten Entscheidungen zumDosenpfand oder zum Verbot der islamistischen Vereinigung«Kalifatsstaat» für Aufsehen.
Gegenwärtig müssen sich die Richter immer häufiger mit Klagen zurTelekommunikation beschäftigen. Thema der Zukunft ist nach Auffassungdes Gerichtspräsidenten vor allem das europäische Recht. Er gehtdavon aus, dass sich das deutsche Verwaltungsrecht dem zunehmendanpassen muss. Hien, dessen Gericht regen Kontakt insbesondere zu denosteuropäischen Nachbarländern pflegt, sieht das mit gemischtenGefühlen. Zumal sich nach seinen Worten das deutsche Verwaltungsrechtim Rahmen der EU-Osterweiterung als «Exportschlager» entwickelt hat.
Immer wieder erhobenen Vorwürfen an die Verwaltungsgerichte, dassVerfahren zu lange dauern und Investitionen behindern, begegnet derJurist selbstbewusst. Trotz unbesetzter Richterstellen gebe es inseinem Haus keine Verfahren, die älter als zwei Jahre sind. «Dasmacht uns kein anderes Bundesgericht nach», sagt Hien. Auch bei einemAnstieg der Eingangszahlen 2002 sei die durchschnittlicheVerfahrensdauer mit neun Monaten gleich geblieben.