30 Jahre Pro Asyl 30 Jahre Pro Asyl: "Politiker haben immer schon gegen Flüchtlinge argumentiert"
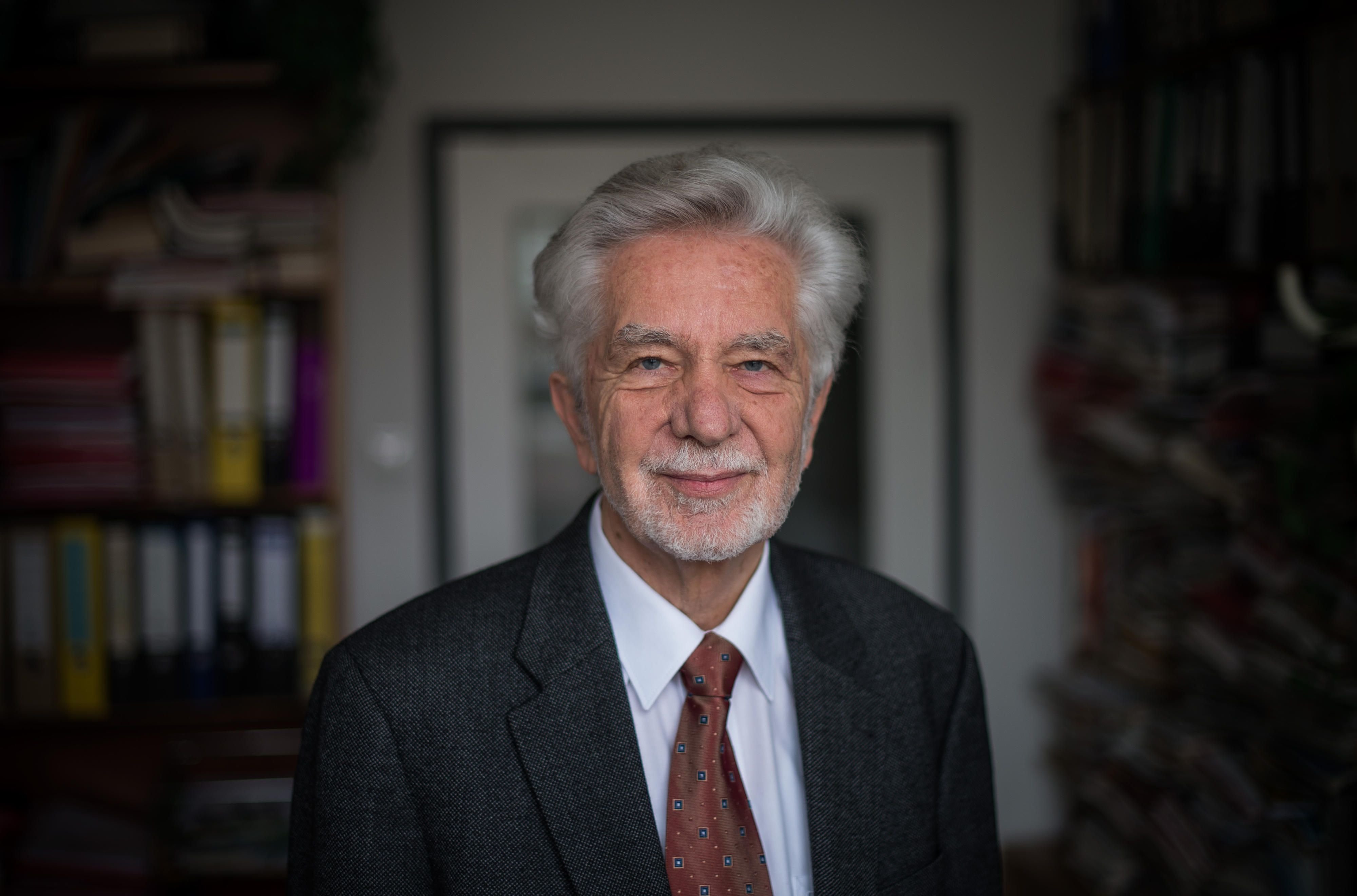
Vor 30 Jahren gründete Jürgen Micksch die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Im Interview erklärt er, wo er Versäumnisse in der Asylpolitik der Regierung erkennt – und warum die Zivilgesellschaft so wichtig ist.
Herr Micksch, was war damals Ihre Motivation Pro Asyl zu gründen?
Jürgen Micksch: 1985 herrschte in Deutschland eine rassistische Stimmung gegenüber Flüchtlingen, dabei kamen damals nicht annähernd so viele Asylbewerber nach Deutschland wie heute. Solch eine Stimmung hängt jedoch weniger von den wirklichen Zahlen ab als von der Wahrnehmung der Menschen – so wie das jetzt bei der AfD der Fall ist. Diese Stimmung damals war so schlimm, dass ich mit Freunden beschlossen habe, etwas zu unternehmen. Wir wollten Flüchtlingen eine Stimme geben. Anders als heute gab es kaum eine Gruppierung, die sich für Flüchtlinge eingesetzt hat. Die Ablehnung ging durch die ganze Gesellschaft. Ende der 80er und Anfang der 90er flüchteten die Menschen vor allem vor dem Balkankrieg nach Deutschland.
Pro Asyl hat inzwischen rund 22.000 Mitglieder. Der Verein wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und ist zu einer wichtigen Stimme für Flüchtlinge geworden. Haben Sie mit diesem Erfolg gerechnet?
Damit konnten wir nicht rechnen. Wir hatten einfach den Wunsch, dass eine Einrichtung entsteht, in der die Stimme für Flüchtlinge erhoben wird. Wir wollten Persönlichkeiten aus Kirchen, Gewerkschaften, wissenschaftlichen Einrichtungen, Flüchtlingsräten und Flüchtlinge miteinander vernetzen – wobei die Mitwirkung von Flüchtlingen immer noch defizitär ist.
Wenn Sie auf die Geschichte von Pro Asyl zurückschauen, welche Momente sind Ihnen am stärksten in Erinnerung geblieben?
Vor allem die Anfangsphasen, wo ich deswegen von vielen Seiten abgelehnt und angefeindet worden bin. Selbst von meiner Kirche wurde ich darum gebeten, mit der Arbeit für Pro Asyl aufzuhören. Wir sind damals von allen politischen Parteien kritisiert worden und wurden als Feinde angesehen. Das hat sich geändert, heute ist Pro Asyl anerkannt. Auch wenn wir die Politik immer noch kritisieren.
Vor einem Jahr sagte die Kanzlerin: „Wir schaffen das.“ Immer mehr Bürger stellen sich inzwischen gegen die Willkommenskultur von Merkel, das zeigt sich vor allem auch beim Erfolg der AfD. Was denken Sie? Schaffen wir das noch?
Wenn wir auf das letzte Jahr schauen, dann ist doch erst einmal festzustellen, dass da unglaublich viel geleistet wurde. Wir haben eine stabile Bewegung von sehr vielen engagierten Menschen in der Bevölkerung, die sich für Flüchtlinge einsetzen. In vielen Kommunen wird Beispielhaftes geleistet. Das gab es vor 30 Jahren bei der Gründung von Pro Asyl nicht. Auch bei der Integration ist Deutschland auf einem besseren Weg. Flucht und Migration sind zu zentralen Themen der Politik geworden. Aber durch die Debatten in den letzten Monaten hat sich in Teilen der Bevölkerung eine gewalttätige Stimmung entwickelt. Wir hatten im letzten Jahr über Tausend Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Das ist eine Katastrophe. Diese vielen Übergriffe auf Flüchtlinge gab es in den 80er-Jahren nicht. Da sind wir als Gesellschaft aufgefordert, etwas zu unternehmen. Das ist heute eine vordringliche Herausforderung. Dass es Menschen gibt, die gegen Flüchtlinge sind, das gab es immer schon. Sogar schon in der Bibel.
„In den 80er-Jahren war die Stimmung gegenüber Flüchtlingen schlimmer als heute“
Glauben Sie, dass diese Stimmung im Land weiter umschlägt?
In den 80er-Jahren war die Stimmung gegenüber Flüchtlingen schlimmer als heute. Neu ist, dass sich Menschen, die gegen Flüchtlinge sind, nun so erfolgreich in politischen Parteien artikulieren und gewalttätig werden. Ich hoffe, dass diese rassistische und unmenschliche Stimmungsmache wieder zurückgeht.
SPD-Chef Gabriel spricht von Obergrenzen, die CSU fordert einen Kurswechsel. Schwenkt die Politik um?
Politiker haben immer schon gegen Flüchtlinge argumentiert. Deswegen kann von einem Kurswechsel nicht die Rede sein. Wir haben eine gespaltene Stimmung zwischen engagierten Menschen und Rassisten. Politiker wollen Mehrheiten. Und wenn die Mehrheit der Bevölkerung rassistisch ist, reden ihnen viele nach dem Munde. Das erleben wir gegenwärtig bei der AfD. Da muss man gegensteuern.
Es gab und gibt immer noch eine große Welle der Solidarität. Ohne die Helfer wären wir vermutlich an der Aufgabe längst gescheitert. Hat die Regierung hier versagt?
Vom Versagen der Regierung spricht es sich immer leicht. Politiker wollen gewählt werden und tun sich daher schwer, für Arme und Flüchtlinge einzutreten. Hier ist die Zivilgesellschaft gefragt. Sie muss gestärkt werden. Dann richten sich auch Politiker danach. Die Politik hat versäumt, diese engagierte Zivilbevölkerung angemessen zu unterstützen. Hier hat der Staat versagt – und versagt weiterhin. So haben wir gegenwärtig eine ständige Zunahme von Rassismus. Es müsste große Programme geben, um diejenigen zu fördern, die sich gegen Rassismus einsetzen.
Neben der Integrationsaufgabe müssen Fluchtursachen bekämpft werden. Werden wir diesem Anspruch gerecht?
Hier gibt es weiterhin unglaubliche Defizite. Jahrelang hat man sich nicht um den Syrien-Krieg gekümmert, der eine entscheidende Fluchtursache ist. Auch Armut ist ein zentrales Thema. Ich beobachte nicht, dass sich da viel verändert.
Gibt es etwas, was man von Flüchtlingen lernen kann?
Ja, Flüchtlinge sind Botschafter für Veränderungen und weisen auf Themen wie die Armut und den Syrien-Krieg hin, die wir vernachlässigen. Ihre Botschaft ist: Tut was!
Zur Person
Jürgen Micksch ist 75 Jahre alt und Theologe und Soziologe. Mit vier Jahren floh er aus Breslau nach Deutschland. Er wirkte als Kinder- und Jugenddarsteller in diversen Theaterstücken mit.
Micksch arbeitete als Pfarrer und war unter anderem Ausländerreferent im Kirchlichen Außenamt in Frankfurt am Main.
1986 gründete er die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl, wo er bis zum Jahr 2012 Vorsitzender war. Seit 2012 ist Micksch Ehrenvorsitzender.
Er gründete außerdem die Münchner Obdachlosenzeitung Deutschlands „Biss“. 1994 gründete Micksch den Interkulturellen Rat in Deutschland, der sich gegen Rassismus und für ein friedliches Zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft engagiert.




